Netzwerk
Mitglieder
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eineinhalb Jahre Vorbereitung, sechs Monate Dreharbeiten, 28 Tage Expedition – mit einem Ziel: Die erste afghanische Frau auf den Gipfel des höchsten Berg Afghanistans zu bringen. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Hanifa Youssefi, 24 Jahre alt, hat es an die Spitze geschafft, auf knapp 7500 Meter. Lange mussten die Details der Expedition aus Sicherheitsgründe geheim gehalten werden. Aber nun, da das Team sicher wieder zu Hause angekommen ist, will Hanifa die Welt wissen lassen: „Ich will eine Heldin für alle Frauen sein.“ Theresa Breuers Reportage über die Expedition und ihr Film „An Uphill Battle“ erscheinen in den kommenden Monaten.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Seit zwei Jahren arbeiten Weltreporterin Theresa Breuer und die amerikanische Fotografin Erin Trieb an einem Dokumentarfilm über das erste weibliche Bergsteigerteam Afghanistans. Die jungen Frauen haben sich vorgenommen, was bisher noch keine Afghanin vor ihnen wagte: Sie wollen den höchsten Berg des Landes erklimmen. Mount Noshaq ist 7500 Meter hoch und selbst für Bergsteigerprofis eine Herausforderung.
 Zudem werden Frauen, die in Afghanistan Sport treiben, sozial geächtet und müssen sich immer wieder gegenüber ihrer Familie und deren Umfeld behaupten. Um die einmalige Expedition zu begleiten, trainieren Breuer und Trieb seit fast zwei Jahren.
Zudem werden Frauen, die in Afghanistan Sport treiben, sozial geächtet und müssen sich immer wieder gegenüber ihrer Familie und deren Umfeld behaupten. Um die einmalige Expedition zu begleiten, trainieren Breuer und Trieb seit fast zwei Jahren.
Wer das Projekt „An Uphill Battle“ unterstützen will, kann das hier tun: https://www.kickstarter.com/projects/erintrieb/an-uphill-battle#
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Vorvergangenen Freitag, 7. April 2017, wurde ein Anschlag in der Stockholmer Innenstadt verübt. Ähnlich wie in Berlin raste ein LKW durch die Fußgängerzone und der Fahrer ermordete so vier Menschen. Vier Menschen, die ihren Angehörigen entrissen wurden und deren Leben durch Terror gewaltsam beendet wurde. Eine schreckliche Tat, die dazu geführt hat, dass viele Schweden öffentlich ihr Mitgefühl ausgedrückt sowie der Polizei gedankt haben.
Über die Hintergründe des mutmaßlichen islamistischen Terroristen habe ich unter anderem für Zeit online (hier über die schwedischen Reaktionen und hier unmittelbar nach der Tat) berichtet und auch einen Kommentar für die Deutsche Welle geschrieben. Auf Artikel und Kommentar wurde wiederum mit einigen Leserkommentaren geantwortet. Die Debatten, die das Internet ermöglicht, sind eine hervorragende Möglichkeit, das Meinungsmonopol (wenn man es denn so nennen möchte) der Journalisten zu brechen.
Ziemlich häufig jedoch, geht es längst nicht um Debatten, sondern was in den Kommentarspalten zu lesen sind, sind Pauschalverurteilungen und Wutausbrüche. Als Antwort auf einige Kommentare unter meinem Kommentar für die Deutsche Welle habe ich selber eine Antwort verfasst. Denn Debatten sind es, die nötig sind, und nicht Pauschalvorwürfe. Hier also meine Antwort (die bei DW nicht mehr veröffentlicht werden konnte, da die Kommentarfunktion nur kurzzeitig offen ist):
“Vielen Dank für die zum großen Teil kritischen Kommentare, auf die ich gerne kurz antworten möchte. Die Angehörigen der Opfer dieser grausamen Tat verdienen unser aller Mitgefühl und denen, die in Stockholm getötet worden sind, gilt es zu gedenken. Das ist bei einer solchen Tat eine Selbstverständlichkeit und anders als manch Kommentator schreibt, meine ich nicht, dass „die Opfer und ihre Familien schnell vergessen werden müssen“. Derartiges steht in meinem Kommentar nicht. Das wird jedem, der diesen wirklich gelesen hat, klar sein.
Was ich in meinem Kommentar hingegen tue, ist auf die gesellschaftlichen Folgen einer derartigen Terrortat zu fokussieren. Das heißt ganz und gar nicht, die schrecklichen Folgen für die Familien in Abrede zu stellen. Dass manch ein Leser es so gelesen hat, gibt mir zu denken, manchmal kommt man nich umhin zu erwägen, ob es Leser gibt, die aus einem Text nur das herauslesen, dass sie lesen möchten. Für eine Familie ist es grausam, einen Angehörigen durch eine derartige Terrortat zu verlieren, diesen gilt unser Mitgefühl.
Im Text erwähne ich auch andere Taten und Unfälle, die in Teilen dem aktuellen Attentat ähneln. Immer wieder wird einem bei Vergleichen der Vorwurf gemacht, gleichzusetzen. Doch vergleichen und gleichsetzen sind verschiedene Dinge. Von daher wird in diesem Text Terror nicht mit einem Unfall gleichgesetzt. Verglichen werden kann, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Das mag manchmal schwieriger sein als einfach gleichzusetzen, doch es sind die differenzierten Betrachtungen, die Diskussionen ermöglichen, die Politik und Gesellschaft weiterbringen können. Wer die Terrorgefahr überhöht und andere Risiken verdrängt (so sind alleine im Januar auf Deutschlands Straßen 234 Menschen ums Leben gekommen – Tendenz glücklicherweise fallend), hat einen großen Wunsch der Terroristen womöglich schon erfüllt: panisch und irrational zu reagieren.
Zuletzt noch kurz zum Zitat des israelischen Historikers Yuval Noah Harari. Es handelt sich selbstverständlich um eine Art bildhaften Vergleich. Ihm geht es explizit darum, was derartiger Terror (die Fliege) mit Europa (der Porzellanladen) macht. Auch Harari spricht also von gesellschaftlichen Auswirkungen und nur weil er die schrecklichen Folgen für die einzelnen Familien nicht erwähnt, negiert er diese noch lange nicht. Es geht auch ihm um eine Betrachtung der möglichen gesellschaftlichen Bedrohung. Das gesamte Interview mit ihm ist im Spiegel 12/2017 erschienen und auch online zu lesen (derzeit jedoch nur gegen Bezahlung). Dass Terrorismus (die Fliege) bekämpft werden sollte, dafür würde sich sicherlich auch Harari aussprechen.
Dass Terror durch geschlossene Grenzen nicht verhindert wird, zeigen Beispiele der letzten Jahrzehnte wie NSU und RAF. Und: Nein, andere (rechts- wie linksxtremistische) Terrortaten zu erwähnen, ist weder Gleichsetzung noch Verharmlosung islamistischen Terrors, sondern lediglich ein differenzierter Beitrag zur Debatte.”
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

14 Tote, 21 Verletzte. 65 Schüsse in der Behinderteneinrichtung, 76 Schüsse auf Polizisten, 380 Schüsse von Polizisten. Ein Dutzend Rohrbomben. Tausende von Pistolen- und Gewehrkugeln. Zwei Verdächtige, zwei tote Verdächtige.
Mit Zahlen versuchen wir das, was am Mittwoch in San Bernardino geschah, zu begreifen.
Wir ergänzen sie mit Hintergrundinformationen: ein Streit auf einer Weihnachtsfeier. Eine Stadt in Armut. Tägliche Gebete in einer Moschee. Lücken in den Waffengesetzen.
Wir sehen Leid, Ärger, Angst, Entschlossenheit und Mitgefühl.
Wir haben das alles schon viel zu oft gesehen: Sondereinsatzkommandos, weinende Menschen, klagende Menschen, Mahnwachen, Gottesdienste, Kerzen, Blumen, Teddybären.
Die Medien reagieren routiniert – auf dem Boden, aus der Luft, in Social Media.
Polizei, FBI, Krankenhäuser und selbst Angehörige der Opfer informieren uns professionell mit regelmäßigen updates, mehr Zahlen und emotionalen Statements.
Ein Imam erzählt von hasserfüllten Nachrichten auf dem Anrufbeantworter im Büro seiner Moschee. #MuslimKillers wird zum Twitter-Trend. Im Kongress werden die üblichen Verdächtigen befragt und geben ihre üblichen Antworten: “Mehr Waffenkontrollen!” sagen die einen “Mehr Waffen!” die anderen, und wer sich raushalten will sagt “Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern.”
Dies war die 355. Massenschießerei in den USA in diesem Jahr. Das Kriterium für diese Zählung: mehr als vier Menschen werden getötet oder verletzt. Die Täter kamen aus unterschiedlichsten Milieus, gehörten unterschiedlichsten Religionen an, waren alt und jung, Einzelgänger und Familienväter.
Ich schreibe das alles auf, lese, höre, schaue und versuche, zu verstehen: warum?
Unmöglich!
Kalifornien hat die strengsten Waffenkontrollen der USA. Trotzdem bekamen die Täter Gewehre, Pistolen, Bomben und kistenweise Munition. Mehr Gesetze reichen nicht. Irgendwas läuft grundsätzlich schief in diesem Land. Um das zu verstehen muss man mehr als Zahlen und erste Berichte sehen. Muss nachhaken, zuhören, genau hinschauen.
Doch bevor dafür Zeit ist, zieht die Medienkarawane schon weiter. Zur nächsten Massenschießerei.
Ich nehme mir vor, zu bleiben.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Stellen Sie sich vor: Der Kopf einer radikalen muslimischen Organisation steht auf einer Bühne zusammen mit 99 anderen Bewohnern seiner Heimatstadt – darunter Menschenrechtsaktivisten, Mitglieder der LGBT-Community und eine ehemalige politische Gefangene, die einst als angebliche Kommunistin jahrelang ohne Gerichtsverhandlung eingesperrt wurde. Und dieser selbst erklärte Extremist sagt ins Mikrophon: „Wir sind ein Leib mit hundert Köpfen.“
Vor einer Woche noch hätte ich dies für ein eher unrealistisches Szenario gehalten. Das war vor der Premiere von „100% Yogyakarta“, einer Kollaboration des deutschen Theaterregisseur-Trios Rimini Protokoll und dem indonesischen Kollektiv Teater Garasi.
Rimini Protokoll brachten ihr 100-Prozent-Konzept bereits in 26 anderen Städten zur Aufführung, bevor sie auf Einladung des Goethe-Instituts nach Yogyakarta kamen, im Rahmen der Deutschen Saison, die zurzeit in mehreren indonesischen Städten läuft. Teater Garasi war ihr lokaler Co-Regie-Partner und unter anderem verantwortlich für den Castingprozess: Fünf Monate lang befragte das Casting-Team nach dem Schnee-Ball-Prinzip unterschiedlichste Personen – immer bemüht, die Kriterien der lokalen Bevölkerungsstatistik zu erfüllen.
„Du denkst, Statistiken sind langweilig?“ fragte „Herr 1%“, Istato Hudayana, ein Beamter der städtischen Statistikbehörde, bevor er die Bühne an seine Mitbürger übergab, die sich einer nach dem anderen vorstellten – von einem einfachen Rikschafahrer bis zu einem reichen Kunstsammler, von einem kleinen Baby bis zu einer 90-jährigen Oma.
Die wichtigsten Kriterien beim Casting waren Alter, Geschlecht, Religion, Familienzusammensetzung und Wohnort. Als zusätzliche Auswahlfilter dienten Ethnizität, kulturelle und sprachliche Vielfalt, Bildung, Beruf, Einkommen und besondere Fähigkeiten.
Das Ergebnis war nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch tief bewegend: Vermutlich begann fast jeder im Publikum nach einer Weile, sich selbst auf die Bühne zu projizieren, als die Menschen dort anfingen, vor allen Leuten ihre tiefsten Ängste und größten Hoffnungen zu gestehen.
Die gemeinsam geteilte Bühne schien den Teilnehmern plötzlich eine Chance zu bieten, genügend Selbstvertrauen zu sammeln, um für ihre Ideale gerade zu stehen, ohne die anderen wegen ihrer gegensätzlichen Ansichten zu verdammen.
Politiker und Aktivisten kämpfen heute hart, um Pluralismus und Toleranz in ihrer Heimatstadt Yogyakarta zu erhalten, genauso wie in anderen Teilen Indonesiens, einst so gerühmt für seine Vielfalt der Kulturen.
Diese hundert Menschen auf der Bühne haben gezeigt, wie viel Toleranz und gegenseitiger Respekt entstehen kann, indem kontroverse Fragen offen und gemeinsam von den Betroffenen selbst diskutiert werden.
„Ich fühlte mich bestens repräsentiert“, bestätigt ein Zuschauer nach der Show. „Dieser Abend hat meine Sicht auf diese Stadt verändert. Und ich bin sicher, dass der gesamte Prozess die Menschen, die an dem Projekt beteiligt waren, noch viel mehr beeinflusst haben muss.“
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
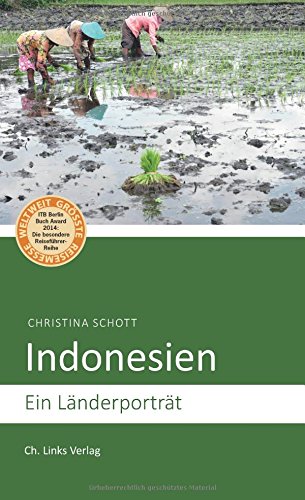
 Im Oktober wird sich Indonesien als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. Ein Land mit unzähligen Facetten, in dem sich rund 300 verschiedene Völker auf mehr als 17 500 Inseln verteilen. Die viertgrößte Bevölkerung der Welt ist zu knapp 90 Prozent muslimisch lebt aber in einer säkularen Demokratie. Zehn Luxuslimousinen in einem Vier-Personen-Haushalt sind genauso alltäglich wie eine zwölfköpfige Familie, die in einer kleinen Bambushütte wohnt. Mehr als 100 Prozent der Bevölkerung besitzen statistisch gesehen ein Handy, aber nicht einmal ein Viertel hat Zugang zum Internet.
Im Oktober wird sich Indonesien als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. Ein Land mit unzähligen Facetten, in dem sich rund 300 verschiedene Völker auf mehr als 17 500 Inseln verteilen. Die viertgrößte Bevölkerung der Welt ist zu knapp 90 Prozent muslimisch lebt aber in einer säkularen Demokratie. Zehn Luxuslimousinen in einem Vier-Personen-Haushalt sind genauso alltäglich wie eine zwölfköpfige Familie, die in einer kleinen Bambushütte wohnt. Mehr als 100 Prozent der Bevölkerung besitzen statistisch gesehen ein Handy, aber nicht einmal ein Viertel hat Zugang zum Internet.
Christina Schott bietet in ihrem neu erschienen Buch einen spannenden Einblick in die Lebenswelten Indonesiens, die faszinierenden wie die besorgniserregenden. Neben den historischen und politischen Fakten macht sie vor allem die sozialen und kulturellen Befindlichkeiten verständlich, die im Alltag der Indonesier eine wichtige Rolle spielen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Überraschen konnte der erneute Anschlag mit islamistischem Hintergrund in Frankreich kaum. Das Land befand sich seit den Anschlägen in Paris im Januar in hoher Alarmbereitschaft. Hatte doch der Islamische Staat (IS) vor rund einem Jahr insbesondere zu Anschlägen gegen Franzosen aufgerufen. Im Hexagon herrscht dennoch Betroffenheit und Entsetzen, aber keine Panik. Die Medien sprechen vom „Schwarzen Freitag“ nach den Anschlägen in Saint-Quentin Fallavier, im tunesischen Sousse und auf eine schiitische Moschee in Kuwait.
Dass die Attentate direkt zusammenhängen ist eher unwahrscheinlich. In Tunesien und in Kuwait bekannten sich inzwischen unterschiedliche Franchisen des Islamischen Staates. Gemeinsam ist aber allen dreien die für den IS typische Barbarei. Sie mögen auch im Zusammenhang stehen mit dem Aufruf des IS, insbesonderer während des islamischen Fastenmonats Ramadan so genannte Märtyrer-Operationen gegen den Feind zu begehen, weil die in seiner verkorksten religiösen Lesart den Märtyrern noch mehr Punkte bringen soll als zu normalen Zeiten. Erwähnenswert ist sicher auch, dass am kommenden Montag der Jahrestag der Ausrufung des Kalifats des IS ansteht. All dies mag für dieses Timing der grausamen Bluttaten sprechen, auch wenn ihre Opfer ganz unterschiedliche waren.
In Frankreich sind die politischen Reaktionen abhängig vom ideologischen Standpunkt. Die einen fordern nun den totalen Krieg gegen die islamistischen Terroristen und darüber hinaus gegen alle extremen Muslime. Die anderen rufen zur Besonnenheit und zur nationalen Einheit sowie der Verteidigung der republikanischen Werte auf. Beides sind im Grunde leere Parolen. Militärisch beziehungsweise mit Polizei- und Geheimdienstmitteln alleine läßt sich diese Problematik nicht lösen. Die totale Sicherheit gibt es ohnehin nicht, das haben schon andere Staaten unter Aufgebot all ihrer Ressourcen vergeblich versucht. Und nationale Einheit?
Zwar können die Franzosen für einen Moment in beeindruckender Weise zusammenstehen, wenn es um die Verteidigung ihrer Gesellschaftsordung geht angesichts radikal-islamistischer Sabotageversuche. Das haben die großen Solidaritätsdemonstrationen im Januar gezeigt. Nur: Das starke gemeinsame symbolische Bekenntnis „Je suis Charlie“ reicht eben nicht, wenn es darum geht sich einer sehr komplexen Problematik zu stellen. Einer, bei der es weder eindimensionale Ursachen noch simple Lösungen gibt.
Ein erster Schritt wäre vielleicht, sich der Realität, in der wir leben – und das nicht nur in Frankreich – in all ihrem Facettenreichtum zu stellen. Verantwortung zu übernehmen, wo sie zu übernehmen ist. Zusammenhänge zu erkennen, wo sie existieren. Ratlosigkeit einzuräumen, wo wir an unsere Grenzen des Verständnisses gelangen. Und dann gemeinsam einen Weg suchen, um Konflikte zu entschärfen. Um so vielleicht gewaltbereiten Extremisten jeglicher Couleur das Wasser abzugraben. In der Tat eine riesige gesellschaftliche Herausforderung. Sind wir dazu bereit?
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Überraschen konnte der erneute Anschlag mit islamistischem Hintergrund in Frankreich kaum. Das Land befand sich seit den Anschlägen in Paris im Januar in hoher Alarmbereitschaft. Hatte doch der Islamische Staat (IS) vor rund einem Jahr insbesondere zu Anschlägen gegen Franzosen aufgerufen. Im Hexagon herrscht dennoch Betroffenheit und Entsetzen, aber keine Panik. Die Medien sprechen vom „Schwarzen Freitag“ nach den Anschlägen in Saint-Quentin Fallavier, im tunesischen Sousse und auf eine schiitische Moschee in Kuwait.
Dass die Attentate direkt zusammenhängen ist eher unwahrscheinlich. In Tunesien und in Kuwait bekannten sich inzwischen unterschiedliche Franchisen des Islamischen Staates. Gemeinsam ist aber allen dreien die für den IS typische Barbarei. Sie mögen auch im Zusammenhang stehen mit dem Aufruf des IS, insbesonderer während des islamischen Fastenmonats Ramadan so genannte Märtyrer-Operationen gegen den Feind zu begehen, weil die in seiner verkorksten religiösen Lesart den Tätern noch mehr Punkte bringen soll als zu normalen Zeiten. Erwähnenswert ist sicher auch, dass am kommenden Montag der Jahrestag der Ausrufung des Kalifats des IS ansteht. All dies mag für dieses Timing der grausamen Bluttaten sprechen, auch wenn ihre Opfer ganz unterschiedliche waren.
In Frankreich sind die politischen Reaktionen abhängig vom ideologischen Standpunkt. Die einen fordern nun den totalen Krieg gegen die islamistischen Terroristen und darüber hinaus gegen alle extremen Muslime. Die anderen rufen zur Besonnenheit und zur nationalen Einheit sowie der Verteidigung der republikanischen Werte auf. Beides sind im Grunde leere Parolen. Militärisch beziehungsweise mit Polizei- und Geheimdienstmitteln alleine läßt sich diese Problematik nicht lösen. Die totale Sicherheit gibt es ohnehin nicht, das haben schon andere Staaten unter Aufgebot all ihrer Ressourcen vergeblich versucht. Und nationale Einheit?
Zwar können die Franzosen für einen Moment in beeindruckender Weise zusammenstehen, wenn es um die Verteidigung ihrer Gesellschaftsordung geht angesichts radikal-islamistischer Sabotageversuche. Das haben die großen Solidaritätsdemonstrationen im Januar gezeigt. Nur: Das starke gemeinsame symbolische Bekenntnis „Je suis Charlie“ reicht eben nicht, wenn es darum geht sich einer sehr komplexen Problematik zu stellen. Einer, bei der es weder eindimensionale Ursachen noch simple Lösungen gibt.
Ein erster Schritt wäre vielleicht, sich der Realität, in der wir leben – und das nicht nur in Frankreich – in all ihrem Facettenreichtum zu stellen. Verantwortung zu übernehmen, wo sie zu übernehmen ist. Zusammenhänge zu erkennen, wo sie existieren. Ratlosigkeit einzuräumen, wo wir an unsere Grenzen des Verständnisses gelangen. Und dann gemeinsam einen Weg suchen, um Konflikte zu entschärfen. Um so vielleicht gewaltbereiten Extremisten jeglicher Couleur das Wasser abzugraben. Eine riesige gesellschaftliche Herausforderung. Sind wir dazu bereit?
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Mittendrin dann plötzlich die heikelste Frage von allen. Zuvor hatten wir den Umbruch in Ägypten diskutiert, die zunehmend repressiven Verhältnisse, die zerstörten Hoffnungen und den Wunsch vieler Ägypter nach Stabilität. Wir hatten versucht, etwas Klarheit in den Schlamassel zu bringen, so gut es eben ging. Wir beschäftigten uns mit Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt.
Aber länger überlegen musste ich erst, als der langjährige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster von mir wissen wollte, ob ich mir vorstellen könnte, in Schwäbisch Gmünd zu leben. Was antwortet man auf solch eine Frage, wenn vor einem knapp hundert stolze Schwäbisch Gmünder sitzen, deren Stuhlreihen so angeordnet sind, dass sie den Fluchtweg versperren?
Natürlich kann ich mir vorstellen, dort zu leben. Schwäbisch Gmünd ist eine feine, mittelkleine Stadt mit herausgeputztem historischen Stadtkern, eine Idylle, die für jeden, der gerade aus Kairo kommt, einen Anblick bietet wie mit Photoshop bildbearbeitet. Außerdem hängt es ja von Tausendundeinem Grund ab, ob man an einem Ort zurechtkommt, allen voran von der Arbeit. (Und da ist Schwäbisch Gmünd für einen Nahostkorrespondenten leider eher weniger geeignet, auch wenn es in Nah-Ostwürttemberg liegt.)
Zusammen mit Jörg Armbruster und Suleman Taufiq, den Herausgebern des Stadtlesebuches »Mein Kairo – My Cairo«, war ich an einem Abend in der Stadtbibliothek des Ortes zu Gast und am darauffolgenden Abend dann im Buchhaus Wittwer in Stuttgart. Der großformatige, edel gestaltete Band mit Texten von rund 50 Autoren ist eine Liebeserklärung an die Millionenmetropole am Nil – der vermutlich einzige Kairo-Bildband, in dem die Pyramiden kein einziges Mal auftauchen, jedenfalls nicht in den 140 spannenden Photographien von Barbara Armbruster und Hala Elkoussy.
In meinem Text erzähle ich von meiner Zeit im ärmlichen, traditionellen Altstadtviertel Bab al-Shaariyya. Unter anderem berichte ich vom benachbarten Tischler, der mal ein geborstenes Wasserrohr in meiner Wohnung mit den Worten reparierte: »Wenn Gott will, dass dein Wasserrohr am Ende wieder ganz ist, dann kriege sogar ich das hin. Wenn Gott dies nicht will, dann schafft das auch kein richtiger Klempner.«
Besser kann man die Entspanntheit gar nicht beschreiben, mit der die Kairoer ihren Alltag am Ende doch immer irgendwie bewältigen. Gleichzeitig ist dieser Ansatz beunruhigend. Man stelle sich vor, der Tischler hätte mich mit denselben Worten am Blinddarm operiert: »Wenn Gott will, dass du den Eingriff überlebst, dann kriege sogar ich das hin. Wenn Gott dies nicht will, dann schafft das auch kein echter Chirurg.«
Infos zu dem dreisprachigen Stadtlesebuch/Bildband (deutsch, englisch, arabisch) auf der Webseite der edition esefeld & traub. Und so fand die Lokalpresse unseren Abend in Schwäbisch Gmünd.

Lesung und Diskussion im Buchhaus Wittwer in Stuttgart: Jörg Armbruster, Jürgen Stryjak, Suleman Taufiq
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Kaum radelte ich heute Nachmittag am See entlang gen Westen jagten auf der anderen Seite des Wassers plötzlich Polizeiwagen mit Blaulicht und Sirene über die Straße. Das kommt hier ständig vor, in der Hinsicht hat man in Kopenhagen manchmal den Eindruck in New York zu leben. Etwas später stellte sich heraus: ein Anschlag! Die gen Osten fahrenden Fahrzeuge waren vermutlich auf dem Weg nach Østerbro.
Mit automatischen Waffen hatten dort kurz vor 16 Uhr zwei Attentäter einen Anschlag auf eine Veranstaltung zum Thema “Kunst, Blasphemie und Meinungsfreiheit” verübt. Sie schossen auf den Veranstaltungsort, anwesende Polizisten erwiderten das Feuer und konnte so womöglich ein Blutbad verhindern. Ein Mann kam ums Leben, drei Polizisten sind verletzt. Im Jahr zehn nach den Mohammedkarikaturen ist der Terror in Kopenhagen angekommen. Oder soll man sagen nach Kopenhagen zurückgekommen, denn Anschlagversuche gab es hier schon zuvor, bisher aber ohne Tote.
Polizei und Politik sind bisher zurückhaltend Vorverurteilungen vorzunehmen, denn noch sind die Attentäter flüchtig. Doch weil Vilks an der Veranstaltung, auf die das Attentat verübt wurde, teilnahm, geht man vielfach wie in Frankreich vor einem Monat von einem islamistischen Hintergrund aus.
Den Stand der Dinge und erste Reaktionen habe ich hier für Die Welt zusammengefasst, hinweisen möchte ich auch auf dieses Interview, dass ich 2010 mit Lars Vilks für Focus führte.
Sie brauchen aktuelle Berichte aus Kopenhagen? bomsdorf@weltreporter.net
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Natürlich trifft Dänemark der Anschlag in Paris ganz besonders. Schließlich waren die berühmt-berüchtigten Mohammed-Karikaturen zuerst in einer dänischen Zeitung erschienen: am 30. September 2005 wurde diese in “Jyllands-Posten” veröffentlicht. Seither gab es Debatten, Demonstrationen und Tote – zuletzt in Paris.
Ein Beitrag zur Meinungsfreiheits-Debatte, der ohne die Karikaturen wohl nicht entstanden wäre, ist das Buch “Karikaturisten im globalen Minenfeld” des dänischen Journalisten Anders Jerichow, Redakteur bei “Politiken”, der linksliberalen Zeitung, die im selben Verlag erscheint wie “Jyllands-Posten”.
Das Buch, 2012 auf Dänisch erschienen, gibt weltweite Beispiele von der gefährdeten Meinungsfreiheit der Karikaturisten. Neben der Karikaturen-Krisegeht es ebenso um ältere und aktuellere Fälle aus Südafrika, Dänemark, den USA, Indonesien und diversen anderen Ländern (Deutschland fehlt übrigens). In Frankreich war Jerichow bei Plantu, der für Le Monde zeichnet.
Für “Die Welt” besuchte ich Jerichow nach Erscheinen des Buches in seinem Kopenhagener Büro. Alleine das Sicherheitsniveau, das dort herrschte und immer noch herrscht, zeigt als wie real die Anschlagsgefahr gesehen wurde und wird. Pläne den Verlag anzugreifen hat es gegeben – glücklicherweise hat die Polizei in Dänemark bisher Terror verhindern können. Hier der zugehörige Artikel in der Online-Version.
Über die Zeichnungen sprach ich vor einigen Jahren auch mit der aus dem Iran stammenden Künstlerin Shirin Neshat, die mir erläuterte, warum auch sie, in New York lebende Weltenbürgerin, sich durch die Zeichnungen gekränkt fühlte. Online zu lesen bei art.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris, kaum mehr als drei Zugstunden von Genf entfernt, hat im Völkerbundpalast Trauer und Entsetzen ausgelöst. Krisen, Krieg und Gewalt gehören für die UN und für die Korrespondenten hier zum Arbeitsalltag. Und trotzdem trifft das Attentat von Paris die Organisation, die UN-Menschenrechtskommissar Zeid al-Hussein bei einem Gedenken am Freitag als globale Familie bezeichnet, ins Herz.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid al-Hussein, bei einer Schweigeminute am 9.1.15 im Genfer Palais des Nations
Das liegt daran, dass nicht nur die Journalisten im Palais das Recht auf freie Meinungsäußerung für eines der unveräußerlichsten Menschenrechte überhaupt halten. “Dieses Recht muss deshalb vehement verteidigt werden, vor allem von den Vereinten Nationen, von mir wie von uns allen”, sagt al-Hussein.
Der gebürtige Jordanier mahnt nach dem Anschlag dazu, innezuhalten anstatt über Rache nachzusinnen. “Es wird noch viel Gewalt geben, und zwar bald, wenn wir uns jetzt nicht klar und menschlich verhalten”, sagt er. “Weder der Islam noch die Multikulturalität Europas sind für den blutigen Überfall vor zwei Tagen verantwortlich, wie es verschiedene rechte Politiker bereits behauptet haben”, betont er.
Al-Hussein, selbst Muslim, geht differenziert auf die umstrittenen Cartoons von Charlie Hebdo ein. “Als Muslim empfinde ich viele der Cartoons, die heute überall wiederveröffentlicht werden, als beleidigend, so wie alle Muslime in diesem Gebäude und überall auf der Welt, alle 1,6 Milliarden”, sagt er. “Aber die Antwort ist natürlich nicht, jemanden zu ermorden oder zu verletzen. Stattdessen müssen wir das gleiche Recht nutzen, dass die getöteten Redakteure von Charlie Hebdo so meisterlich genutzt haben: das Recht, frei zu schreiben, zu sprechen und zu zeichnen.”
Für den Menschenrechtskommissar ist längst erwiesen, dass das Wort mächtiger ist als das Schwert oder eine andere Waffe. “Wir müssen über die Notwendigkeit sprechen, mehr zu lieben, uns mehr zu kümmern, gütig zu sein, mehr Menschen zu intergrieren und besser integriert zu sein: Wenn wir irgendeine Lehre aus diesen teuflischen Morden ziehen können, dann ist es diese.”
Die UN kranken oft daran, keine klaren Positionen beziehen zu können. Wer 193 Staaten repräsentiert, spricht oft verklausuliert. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo haben die UN klare Worte gesprochen, in Genf und in New York. Das lässt hoffen, dass sie im Kampf gegen Terror und Extremismus auf allen Seiten in den kommenden Wochen ihr ganzes Gewicht in die Wagschaale werfen wird.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Am 26. Dezember 2004 war ich über Weihnachten in Berlin und hörte morgens im Radio die Nachricht, dass es vor Nordsumatra ein Seebeben gegeben hatte. Ich machte mir erst einmal nicht allzu viele Gedanken. Solche Nachrichten gibt es in Indonesien regelmäßig. Neun Tote im Osten der Insel wurden gemeldet, einige Brücken seien zerstört. Aus deutscher – und anfangs selbst aus indonesischer – Mediensicht also kein großes Ereignis, noch dazu am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich trank in Ruhe Kaffee.

Tsunami-Gedenkstätte in Banda Aceh, Indonesien: ein 2.600 Tonnen schweres Generatorschiff, das vier Kilometer weit ins Landesinnere gespült wurde, Foto: Florian Kopp/Misereor
Doch die Nachrichten über das Seebeben verschlimmerten sich laufend: Erst kamen Berichte von tausenden Toten, die bei einem Tsunami im Süden Thailands gestorben waren, wenig später folgten ähnliche Meldungen aus Sri Lanka, Indien und von den Malediven. Der gesamte Indische Ozean schien rundherum über seinen Rand geschwappt zu sein, die Todeszahlen stiegen stündlich. Nur aus Aceh, der nördlichsten Provinz Sumatras hörte man gar nichts. Und das obwohl das Epizentrum des drittgrößten Bebens, das je gemessen wurde, nur 85 Kilometer vor der acehnesischen Küste lag. Mich beschlich ein dumpfes Gefühl. Ein Anruf bei Kollegen in Jakarta bestätigte die Vorahnung, dass die schlimmsten Nachrichten noch ausstanden. Gegen Abend fragte ein großes Nachrichtenmagazin an, ob ich für die Tsunami-Berichterstattung auf die Malediven fliegen wolle. Ich lehnte ab und schlug vor, stattdessen früher nach Indonesien zurückzufliegen. Die Redaktion hielt das nicht für nötig – dort sei ja nicht so viel passiert. Laut Nachrichten.
Es dauerte tatsächlich mehrere Tage, bis die Welt anfing zu verstehen, warum es kaum Nachrichten aus Aceh gab. Aufgrund eines fast dreißigjährigen Unabhängigkeitskriegs stand die indonesische Provinz zu jenem Zeitpunkt unter Kriegsrecht und war von der Außenwelt weitestgehend isoliert. Nichtregierungsorganisationen und Ausländer durften nur mit Sondergenehmigung einreisen. Knapp zwei Tage dauerte es, bis die ersten indonesischen Hilfs- und Reporterteams sich über die vom Erdbeben zerstörten Straßen und Militärblockaden bis zur Westküste der Provinz durchgekämpft hatten und berichten konnten. Das Schreckensszenario dort überstieg jede Vorstellung: Über Hunderte von Kilometern waren ganze Küstenstreifen einfach ausradiert. Häuser, Bäume, Straßen – alles weg. Nur die platten Fundamente erinnerten noch daran, dass hier einmal Menschen gelebt hatten. In manchen Orten hatten gerade einmal zehn Prozent der Bevölkerung überlebt, mit wenigen Ausnahmen diejenigen, die zum Zeitpunkt der Katastrophe nicht zu Hause waren. Die Überlebenden zogen sich unter Schock und zum Teil schwer verletzt in die Berge zurück. Strom- und Telefonnetz waren komplett zusammen gebrochen, es war unmöglich, Hilfe herbeizurufen. Viele mussten tagelange Fußmärsche auf sich nehmen, um Lebensmittel oder ärztliche Versorgung für zurückgebliebene Angehörige zu besorgen.
Heute wissen wir, dass der Tsunami allein in Aceh 170.000 Menschen in den Tod riss. Als ich genau eine Woche nach der Katastrophe am Flughafen von Jakarta landete, hatte ich ein Dutzend SMS auf dem Handy: alle von Redaktionen, die mich plötzlich schnellstmöglich auf dem Weg nach Aceh sehen wollten. Es war abzusehen, dass der größte Tsunami unserer Geschichte noch Wochen und Monate die globalen Nachrichten beherrschen würde. Denn was jetzt folgte, war die größte Spendenaktion aller Zeiten.
Seit meiner Ankunft in Banda Aceh weiß ich, wie Leichen riechen. Zehn Tage nach der Katastrophe lag über der ganzen Stadt der süßliche Gestank der Verwesung. Rund 2000 aufgedunsene Körper zogen die Bergungstrupps jeden Tag aus Flussmündungen, unter Trümmern und Schutt hervor und fuhren sie auf großen Lastwagen in Massengräber. Jeder Gesprächspartner hatte Verwandte und Freunde verloren. In den am schlimmsten betroffenen Orten waren manche Familien komplett ausgelöscht worden. Die Überlebenden quetschten sich in Schulen oder Zeltlager. Die meisten hatten noch gar nicht realisiert, was eigentlich passiert war. Wo sich die 12 bis 30 Meter hohen Wellen mit voller Wucht hinübergewalzt hatten, war nicht mehr viel zu sehen außer ein paar Kokospalmen und vereinzelten Hausskeletten. Der Grenzstreifen der Todeszone lag etwa fünf Kilometer stadteinwärts: Hier stapelten sich Hausrat, zerquetschte Autos und die Überreste derer, die sich nirgends mehr hatten festhalten können. Mittendrin, fast unversehrt, lagen riesige Schiffe, als hätte sie ein Riese beim Spielen aus Versehen dort fallen lassen.
„Ist das Deine erste Katastrophe?“ fragte mich ein krisenerfahrener Kollege, mit dem ich zusammenarbeitete, und fügte – nicht sehr aufmunternd – hinzu: „Na, dann hast Du es ja gleich richtig erwischt.“ Dank seiner Unterstützung habe ich meine Arbeit trotzdem irgendwie geschafft. Nach einer Woche konnte ich wieder nach Hause fliegen. Es fühlte sich an wie der erste tiefe Atemzug an der frischen Luft nach einem längeren Tauchgang. Zwar spukten manche Bilder und Gespräche noch eine Weile im Kopf herum, doch die Katastrophe rückte wieder weit genug weg, um ein Nachrichtenbild im Fernseher zu werden. In den kommenden anderthalb Jahren flog ich noch mehrmals nach Aceh. Die Bedingungen wurden besser und ich härtete ab. Ich absolvierte das ABC der Katastrophenberichterstattung und zugleich noch einen Schnellkurs in internationaler Nothilfe und Entwicklungsarbeit. Doch die Betroffenen selbst konnten nicht einfach wegfliegen und die Tür hinter sich zu machen. Wie haben sie ihre schrecklichen Erinnerungen verarbeitet?
Zehn Jahre nach dem großen Tsunami von 2004 fuhr ich noch einmal nach Aceh. Diesmal um über das heutige Leben dort zu berichten, über den längst abgeschlossenen Wiederaufbau und den Frieden, den die Katastrophe der umkämpften Provinz brachte. Aber auch über die Scharia, die in der autonomen Provinz immer schärfer eingeführt wurde. Natürlich kamen Erinnerungen hoch. Ein Dokumentarfilm im Tsunami-Museum von Banda Aceh versetzte eine ganze Besuchergruppe in hemmungsloses Schluchzen und eine Mutter erzählte mir mit Tränen in den Augen, dass sie bis heute das Gefühl hat, einer ihrer beim Tsunami verschwundenen Söhne würde noch irgendwo leben.
Ich fühlte mich nicht wohl, die Frau durch meine Fragen nach den schrecklichen Erinnerungen so aufzuwühlen. Der Helfer jedoch, der mir den Kontakt vermittelt hatte, sagte: „Mach Dir keine Sorgen, das macht sie oft – und danach geht’s ihr wieder besser. Dieses Mitteilen ist ihre Form von Selbsttherapie.“ Schon zehn Jahre zuvor war ich tief beeindruckt, wie offen und freundlich die Opfer auf die Fragen fremder Besucher antworteten. Selbst im Zeltlager bekam ich manchmal noch etwas zu Trinken angeboten.
Internationale Hilfsorganisationen gehen automatisch davon aus, dass Opfer einer großen Naturkatastrophe posttraumatische Stresssymptome zeigen müssen, und richten ihre Einsätze demzufolge aus. Bei der psychologischen Betreuung in Aceh sind sie mit diesem Denkansatz kläglich gescheitert. Der Umgang mit den traumatischen Erfahrungen in Indonesien ist anders als bei uns. Alles mit der Gemeinschaft teilen ist dabei ein wichtiger Punkt, Religion ein andere. Die meisten Acehnesen glauben, dass der Tsunami eine Strafe Gottes für das Blutvergießen im Bürgerkrieg war. Durch diesen Glauben an eine göttliche Vorbestimmung und durch ihren kollektiven Lebensstil haben sich viele auf ihre eigene Art von den traumatischen Erinnerungen befreit. Fast alle Interviewpartner sagten, dass die psychischen Nachwirkungen des Bürgerkriegs bis heute viel schlimmer seien als die des Tsunamis: Gegen die Naturkatastrophe seien sie völlig machtlos und alle gleichermaßen betroffen gewesen. Während des Konflikts jedoch haben sich Menschen gegenseitig gequält und umgebracht, ohne dass irgendein höherer Sinn dahinter erkenntlich gewesen sei. Der Friede sei somit auch ein Geschenk Gottes.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

 In diesen Gottesdienst in einer kleinen armenischen Kirche im Istanbuler Stadtteil Kadiköy wanderte Susanne Güsten zufällig hinein, als sie auf der Suche nach einer anderen Kirche war – nach der Konzilskirche von Chalcedon, wo im Jahr 451 das vierte Ökumenische Konzil der Christenheit tagte: “Ich freute mich, eine orientalisch-orthodoxe Kirche an jenem Ort vorzufinden, wo diese sich seinerzeit von der übrigen Christenheit abspaltete. Den Ort der ursprünglichen Konzilskirche fand ich später auch noch, dort steht heute eine relativ neue griechisch-orthodoxe Kirche. Die Türkei mag ein moslemisches Land sein, doch die Wurzeln der Christenheit stecken tief in ihrer Erde und sind auch noch nicht abgestorben.”
In diesen Gottesdienst in einer kleinen armenischen Kirche im Istanbuler Stadtteil Kadiköy wanderte Susanne Güsten zufällig hinein, als sie auf der Suche nach einer anderen Kirche war – nach der Konzilskirche von Chalcedon, wo im Jahr 451 das vierte Ökumenische Konzil der Christenheit tagte: “Ich freute mich, eine orientalisch-orthodoxe Kirche an jenem Ort vorzufinden, wo diese sich seinerzeit von der übrigen Christenheit abspaltete. Den Ort der ursprünglichen Konzilskirche fand ich später auch noch, dort steht heute eine relativ neue griechisch-orthodoxe Kirche. Die Türkei mag ein moslemisches Land sein, doch die Wurzeln der Christenheit stecken tief in ihrer Erde und sind auch noch nicht abgestorben.”
Susanne Güsten, geboren 1963 in München, aufgewachsen in Westafrika, Schulabschluss in den USA, Studium der Politikwissenschaften in Deutschland, Absolventin der Deutschen Journalistenschule; Redakteurin, Reporterin und zuletzt stellvertretende Chefredakteurin der Nachrichtenagentur AFP in Deutschland; seit 1997 als freie Korrespondentin in Istanbul. Susanne Güsten berichtet aus der Türkei und Nordzypern unter anderem für den Tagesspiegel und den Deutschlandfunk.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

… aus Nizamuddin in Neu Delhi. Diesen O-Ton haben wir aus einem Video herausgenommen, das Michael Radunski in Delhis Stadtteil Nizamuddin aufgenommen hat, in einem kleinen Hinterhof vor dem Mogul-Grab Chausath Khamba. Was wir hier hören ist “Qawwali”, ist ein zum Sufismus gehörender Gesangsstil, der ursprünglich aus der ehemaligen Provinz Punjab im heutigen Pakistan und Nordindien stammt.
Das Grab im Hinterhof wurde 1623 erbaut und hütet die Gebeine des Mogul-Kaisers Mirza Aziz Kokaltash. Der Name Chausath leitet sich von der impossanten Deckenkonstruktion ab, die auf 64 Marmorsäulen ruht (Chausath = 64). Seit 2011 wurde das Grabmal mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Delhi restauriert und nun feierlich mit Qawwali-Gesang für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Michael hat das Video extra für den Adventskalender aufgenommen.
Bevor Michael 2012 nach Neu Delhi kam, hat er in England und China gelebt. In seinen Reportagen, Interviews und Porträts erzählt er nun von einem Land, das ihn durch seine Unterschiedlichkeit fasziniert.
(Fotos: co Deutsche Botschaft Neu Delhi/German Embassy New Delhi)
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Birgit Svensson lebt und arbeitet seit Jahren in Bagdad. Als freie Journalistin an einem der aktuell gefährlichsten Orte schreibt und berichtet sie u.a. für DIE ZEIT, die WELT, den Deutschlandfunk, den Schweizer Rundfunk und die Deutsche Welle. Sie ist eine der ganz wenigen Frauen, die vor Ort das aktuelle Chaos , die dramatischen Veränderungen erleben. Noch im letzten Jahr musste sie um ihren Verbleib in Bagdad kämpfen, für viele Medien schien der Irak uninteressant. Jetzt sind sie alle wieder interessiert, wollen Berichte und Reportagen.
Wie Birgit Svensson das alles erlebt. wie sie mit dem Problem Sicherheit umgeht, wie dieser Bürgerkrieg auch sie verändert – darüber redet sie auf dieser Veranstaltung. Und stellt sich all den Fragen derer, die Bagdad und den Irak nur vom Fernseher oder den Zeitungen kennen.
Mit Christoph Reuter, Spiegel.
Heute, Freitag, 4. Juli, 14.15 Uhr Netzwerk Recherche-Tagung, NDR Gelände Lokstedt, Hugh-Greene-Weg.
BIRGIT SVENSSON noch einmal HEUTE um 15.30 Uhr: Lasst uns über Geld reden. Neue Modelle für Freie im Ausland. Moderation: Gemma Pörzgen, Freischreiber.
BITTE AKTUELLE RAUM-HINWEISE BEACHTEN!
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Hammel, überall blöken die Hammel. Die Autobahnen und Landstraßen sind voller Pick Up Trucks auf deren Ladenflächen sich Dutzende Tiere quetschen. Auf den Plätzen vor den Städten sind sie zu Hunderten zu sehen. Männer laufen herum und suchen sich ein Tier aus. Bündel von Geldscheinen wechseln den Besitzer. Der Grund: Das Islamische Opferfest steht bevor. Am heutigen 15. Oktober feiern die Muslime überall auf der Welt Aid al Adha oder Aid el Kebir, wie der Tag im Maghreb genannt wird. Jedes Familienoberhaupt ist angehalten ein Tier zu schlachten. In den meisten Länder sind es Hammel.
Das Tier wird einige Tage zuvor gekauf, denn Last-Minute ist teuerer. Stellt sich vor allem in der Stadt die Frage: Wohin mit dem Vieh? In Algerien erlebte ich das Opferfest vor einigen Jahren mit und konnte mir vom Einfallsreichtum der Städter selbst ein Bild machen. Wer zu den wenigen gehört, die in einem Ein- oder Zweifamilienhaus leben, hält das Tier in der Garage oder im Innenhof. Wer unweit eines Parks lebt, markiert seinen Hammel und lagert ihn dort zwischen. Die Tiere fressen die Parkvegetation, während ein Wächter aufpasst, dass sie nicht gestohlen werden. Schwieriger wird es da schon in den monotonen Wohnblocks der Vororte mit ihren viel zu engen Wohnungen. Hier bevölkern die Hammel die Balkone und selbst die Absätze im Treppenhaus. Es riecht entsprechend.
Am Opferfest dann, werden die Tiere auf die Straße geführt, um ihnen – den Blick gen Mekka gerichtet – mit einem Messer die Gurgel durchzuschneiden. Überall in der Stadt fließt das Blut. Nicht jeder Mann in der Familie ist geeignet das Opfer darzubringen. Er muss ein guter Muslim sein. Viele meiner Freunde haben deshalb noch nie das Messer geführt und wollen das auch nicht. “Ich trinke doch Bier”, heißt die Entschuldigung, um sich vor dieser Aufgabe zu drücken.
Es ist kein billiges Fest. Dieses Jahr kosten die Tiere in Algerien um die 450 Euro. Das ist das dreifache des Mindestlohnes. Viele Tiere müssen importiert werden, da Algeriens Viehwirtschaft nicht ausreicht, das gesamte Land zu versorgen. Wer sich einen Hammel leisten kann, und einem Armen Nachbarn hat, ist angehalten, ein Stück Fleisch abzugeben.
Das Opferfest geht übrigens auf das Alte Testament zurück. Der Koran hat die Geschichte des Propheten Ibrahim (Abraham) übernommen. Das Hammelopfer gedenkt der Bereitschaft Ibrahims seinen Sohn Ismael (Isaak) aus Furcht vor Gott, soll heißen Allah, zu opfern. Als Allah – Gott – seine Bereitschaft und sein Gottvertrauen sah, gebot er ihm Einhalt und Ibrahim und Ismail opferten daraufhin voller Dankbarkeit im Kreis von Freunden und Bedürftigen einen Widder. Die Geschichte wird im Koran in Sure 37,99-113 erzählt. Ihr biblisches Pendant ist die Erzählung von der Opferung Isaaks (Gen 22,1-19 EU).
Am Festtag selbst, werden die Innereien zubereitet. Sie verderben am schnellsten und das Hammelfleisch an sich muss einige Zeit abhängen, um genießbar zu sein. Wer an so einem Opfertag eingeladen wird, bekommt das beste Stück aufgetischt. In meinem Falle waren es die Hoden. Unter dem aufmerksamen Blicken meiner Gastfamilie verzehrte ich den Leckerbissen und spülte mit amerikanischer Brause nach. Probe bestanden!
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Aus aktuellem Anlass ein paar Worte zur »gelben Gefahr«, weil mir vorhin auf Facebook jemand Folgendes schrieb:
»Ich frage mich, warum der gelbe Hintergrund in Ihrem Facebook-Profilfoto, der aktuell als Kennzeichen der Muslimbrüder-Sympathisanten angesehen wird? Ich erwarte Neutralität von Journalistinnen und Journalisten!«
Nun, ähemm, das Foto steht so, wie es aussieht, seit April 2011 auf meiner Facebook-Seite, weil ich damals dachte, dass rot und gelb zusammen so’ne schöne Signalwirkung entfalten. Hat mir einfach gut gefallen. Dass es die Farbe der Muslimbrüder sein soll, ist mir unbekannt (seit GESTERN verwenden sie allerdings einen gelben Hintergrund in einem ihrer Protestlogos). Man könnte über den Vorwurf an mich lachen, wenn er nicht ein Beispiel dafür wäre, wie so manchem Ägypter (und Deutschen in Ägypten und Deutschen in Deutschland, der sich für Ägypten interessiert) in dieser Atmosphäre der Hysterie die Nerven durchgehen.
Ich richte ja nie meine Berichterstattung an den Stimmungswogen der Leute aus. Eine der Hauptfragen, die ich mir beim Recherchieren und Schreiben selber stelle, lautet: »Ist das, was ich sehe, jetzt wirklich das, was ich denke, was es ist…?« Will sagen: Es gibt ziemlich viele Gründe dafür, immer und überall kritisch unter die Oberfläche zu gucken. Was Ägypten betrifft, gilt das nicht nur für die Islamisten, auch für Militär, Sicherheitskräfte, Opposition usw. usf. Alles andere wäre journalistisch falsch (und außerdem sterbenslangweilig).
Ich weiß, dass das schwierig für jene ist, die nach einfachen ›Wahrheiten‹ dürsten, nach solchen, die am besten auch noch ihren Stimmungen und Erwartungen entsprechen. Ich verstehe das ja, aber es ist journalistisch nicht machbar. Ich erhalte auch Post, in denen Unterstellungen stehen wie: »Sie haben doch die Muslimbruderschaft immer geschont und die Gefahr verharmlost!« — Wahlweise steht statt Sie auch gern Ihr für »Ihr Journalisten«…
Wen es interessiert, ich verlinke hier mal ein paar meiner Beiträge, die ich eben auf die Schnelle rausgesucht habe. Das soll keine Rechtfertigungsein (dazu gibt es keinen Grund), sondern eine Ermunterung dazu, mal ein bisschen genauer in die deutschen Medien hineinzugucken oder hineinzuhören. Da gibt es bei meinen Kollegen (auch von WELTREPORTER.NET) ne ganze Menge zu entdecken, zum Beispiel in den Tageszeitungen und auf den öffentlich-rechtlichen Radiosendern (sehr empfehlenswert!) und zum Beispiel besonders auch bei Karim El-Gawhary.
Hier Links zu ARD-Hörfunkbeiträgen von mir aus dem Frühjahr und Winter:
Das folgende Stück hier wurde knapp drei Monate vor der Entmachtung Mursis gesendet, ich lasse einen ägyptischen Gesprächspartner erklären, warum er die Ideologie der Muslimbruderschaft für gefährlich & faschistisch hält :
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2013/04/12/drk_20130412_2248_aeceaafc.mp3
Hier zu Menschenrechtsverletzungen unter Mursi (April 2013):
http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2013/02/11/drk_20130211_1214_7d7da371.mp3
Hier genau zur Hälfte der Amtszeit Mursis (Januar 2013), ebenfalls über Menschenrechtsverletzungen und repressive Politik:
http://www.tagesschau.de/ausland/aegypten1410.html
Hier die ersten Massenproteste gegen Mursi & Muslimbruderschaft im Dezember 2012:
http://www.tagesschau.de/ausland/aegypten-proteste110.html
Das sind einige von vielen Beispielen. Auf den Text-Webseiten gibt es jeweils immer auch ein Audio-Logo, auf das man klicken kann, um sich das jeweilige Stück anzuhören.
Mal auch ganz spannend für mich, in der Rückschau zu gucken, wie die eigene Berichterstattung damals aussah. ■
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Dass die Wahrheit in Konflikten auf der Strecke bleibt, ist eine Binsenweisheit, ebenso wie die Tatsache, dass mit Informationen Politik gemacht wird. Geschenkt. Es gibt nichts, das ein Journalist nicht kritisch abklopfen muss.
Am 26. Januar 2011, dem zweiten Tag des ägyptischen Volksaufstandes gegen Mubarak, bin ich tagsüber zu drei Orten in der Nähe des ARD-Studios gegangen, für die Regimegegner Demos mit mehreren Tausend Menschen über Twitter und auf Facebook vermeldet hatten. An nicht einem der drei Orte traf ich auch nur einen einzigen Demonstranten an.
Bei Opferzahlen sieht’s nicht anders aus. Wem hohe Zahlen nutzen, der vermeldet hohe Zahlen, wem nicht, der nicht. Fotos von Kindern, die das ägyptische Militär angeblich bei ihren brutalen Angriffen gegen Mursi-Anhänger in Kairo tötete, erwiesen sich später als Bilder von Kinderleichen aus Syrien.
Diese Bilder waren auf Webseiten aufgetaucht, die der Muslimbruderschaft nahestehen. Andere Webseiten fanden die Quelle und stellten die Screenshots der ägyptischen sowie der syrischen Webseite nebeneinander –beide zeigen dasselbe Massakerfoto, nur mit einer anderen Bildunterschrift.
Ich habe aber auch schon Webseiten mit solchen Gegenüberstellungen gesehen, bei denen der »Beweis«, also der Screenshot von der Webseite mit dem angeblichen Originalfoto, eine Fälschung war – und das angeblich »entlarvte« Foto aber echt. Alles ziemlich verworren.
Gestern tauchten in Ägypten Fotos von Männern in Zivil auf, die mit Maschinengewehren bewaffnet am Rande von Demonstrationen durch Kairos Straßen liefen. Angeblich soll es sich um bewaffnete Mursi-Anhänger gehandelt haben. Das kann stimmen, ich habe selber in den letzten Wochen Mursi-Anhänger mit Waffen gesehen. Die Behauptung kann aber auch falsch sein. Andere Fotos von gestern zeigen Männer in Zivil und mit Maschinengewehren, die mit Polizisten in der Sonne stehen, plaudern und ganz offensichtlich zu ihnen gehören.
Zu welcher ‘Seite’ gehören Männer in Zivil, die in der Nähe von Protesten mit Waffen rumlaufen? Das Publikum entscheidet sich für die Antwort, die es hören will. Das ist der Hauptpunkt. Nur wenige der vielen Falschinformationen und Behauptungen dienen noch dazu, einen Beweis zu suggerieren. Sie sollen einfach nur Stimmungen beeinflussen, bei Leuten, die ohnehin schon in einer bestimmten Weise gestimmt sind.
Es ist inzwischen völlig egal, wie plausibel diese Behauptungen sind. Sie tauchen auf, sie putschen auf. Sie sind ein paar Stunden später schon wieder aus der Wahrnehmung verschwunden und haben ihren Zweck erfüllt. Im Zeitalter von Social Media und von Fernsehbildschirmen, die rund um die Uhr flimmern, erwartet niemand mehr, das irgendwas von dieser Informationsflut später dementiert oder entlarvt wird. Es guckt sich alles einfach so weg.
Seit Mittwoch wurden in Ägypten landesweit mehrere Dutzend Kirchen gestürmt, verwüstet und/oder in Brand gesteckt. Ich habe in Videoaufnahmen Täter gesehen, bei denen es sich mit ziemlicher Sicherheit um Sympathisanten von Mursi und der Muslimbruderschaft handelte – zur ‘Rache’ womöglich angefeuert durch die Reden, die wochenlang von der Protestcamp-Bühne an der Rabaa-al-Adawiyya-Moschee hallten und in denen aufs Übelste immer wieder auch gegen Christen gehetzt wurde.
Auf Aufnahmen von anderen der attackierten Kirchen sah ich Angreifer, die mit Pick-up-Trucks kamen und bei denen es sich unverkennbar um Baltagiyya-Schlägertrupps handelte, um jene meist jungen, verrohten Männer aus Armenvierteln, die seit Jahrzehnten für Funktionäre der Mubarak-Nomenklatura die Drecksarbeit machen, nicht selten vollgepumpt mit Bango (Marihuana), und die ein paar ägyptische Pfund für ihren Einsatz erhalten.
Eine ägyptische Koptin aus Beni Suef (die ich nicht kenne und für deren Äußerungen ich nicht bürgen kann) schrieb auf ihrer Facebook-Seite (mehrere Tausend Abonnenten): »Glaubt mir! Die, die bei uns im Ort die Kirchen anzündeten, waren Geheimdienstleute in Zivil und Männer von der NDP (Mubaraks 2011 aufgelöster Regierungspartei).« In einem Fernsehinterview an jenem Mittwoch erzählt ein koptischer Kirchenfunktionär aus Al-Minya, dass die Angriffe auf alle Kirchen im Ort exakt zur selben Zeit nach demselben Muster abliefen und vor allem in jenem Moment im Morgengrauen stattfanden, als in Kairo die brutale Räumung der Protestcamps der Mursi-Anhänger gerade begonnen hatte. Die Kopten riefen die Polizei an und baten um Schutz und Hilfe, aber bei keiner der überfallenen Kirchen habe sich die Polizei blicken lassen, bis zum Schluss nicht.
Es bleibt einem nichts weiter übrig, als sich auf all das irgendwie selber einen Reim zu machen – indem man so aufwändig und so kritisch wie möglich recherchiert und indem man die eigenen, Jahre langen Erfahrungen bei der Beurteilung hinzuzieht. Nach dem, was ich von den Überfällen auf die Kirchen gesehen habe, würde ich sagen: sowohl radikale, aufgehetzte Mursi-Sympathisanten als auch koordiniert agierende Angreifer, die Überfälle orchestrierten, die den Islamisten in die Schuhe geschoben werden können.
Vorfälle dieser und ähnlicher Art müssten von offizieller Seite untersucht werden. Nach jedem Blutbad der letzten zweieinhalb Jahre wurde schonungslose Aufklärung versprochen, aber ich kann mich an keinen einzigen Untersuchungsbericht erinnern. Und wenn es Pressekonferenzen gab, auf denen »Untersuchungsergebnisse« präsentiert wurden, waren sie keine einzige der Minuten wert, die man für sie opferte.
Im Oktober 2011 habe ich sechs Stunden lang aus nächster Nähe mit ansehen müssen (ich konnte den Ort nicht verlassen), wie das ägyptische Militär vor dem TV-Gebäude Maspero ein Massaker unter Teilnehmern einer Christendemonstration verübte. Ich sah Soldaten, die auf Menschen schossen (die dann getroffen zusammensackten), ich sah, wie gepanzerte Militärfahrzeuge über Demonstranten fuhren. Am Ende waren mindestens 27 Menschen tot.
Ein paar Tage später gaben Armeeoffiziere auf einer Pressekonferenz die offizielle Version der Militärs bekannt. Fast alles, was sie sagten, war praktisch das Gegenteil von dem, was ich selber gesehen hatte. Ähnliche Erfahrungen macht man immer wieder auch mit Erklärungen anderer Behörden. Es ist leider so, dass die Informationen offizieller Stellen in Ägypten keinen Wert haben. Sie können stimmen (und tun das womöglich hin und wieder auch), aber sie können ebenso gut auch komplett dem Reich der Phantasie entstammen. Man könnte sie eigentlich ignorieren. Sie helfen einem bei der Suche nach dem Hergang der Ereignisse keinen einzigen Millimeter weiter. ■
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Zu wenig dringt vom australischen Wahlkampf in den Rest der Welt vor. Was schade ist, denn wenn die nächsten 4 Wochen bis zur Wahl nur ansatzweise so skurril weitergehen, wie sie angefangen haben, wird’s zum Schreien. Kostprobe gefällig? Gern! Gestern zb gab eine junge Kandidatin der “One Nation” Partei (so eine Art australische Le-Pen- oder Sarah-Palin-Truppe) ein Interview und erklärte : Sie sei jetzt nicht generell gegen Islam als Land, aber deren Gesetze sollten lieber nicht in Australien gelten. Okay, ich verstehe, Sie brennen darauf, den Namen dieser politischen Wunderwaffe kennen zu lernen: Verständlich, denn Stephanie Banister, mit 27 Jahren das jüngste “poster girl” ihrer politischen Vereinigung, hat noch weitere Weisheiten in Sachen Religion parat. Da Skepsis in diesen schnellmedialen Zeiten angebracht ist, hören Sie sich den Beweis aus Australiens öffentlichem Fernsehen auf Youtube an. Es lohnt! Sarah, sorry Stephanie weiß auch: Nur 2 Prozent aller Australier etwa folgten dem Haram (sie meinte Koran, haram ist ein muslimischer Terminus für etwas das verboten ist )
http://www.youtube.com/watch?v=6_1SFf8t-ko
Dann belehrte sie noch: Juden hätten andere Diätvorschriften (nicht haram sondern kosher und steuerfrei), aber Juden hätten ja eh ihre “eigene Religion, welche nämlich Jesus Christus folge”. Autsch, ich glaube Stephanie muss wirklich muss noch mal zurück in Jahrgang 10, wo’s um “Religionen dieser Welt” ging. Denn Glaube und Gott sind ihr Lieblingsthema (sagt sie). Kaum nötig zu erwähnen, dass die aufstrebende Politikerin sich am nächsten Tag beschwerte und falsch zitiert fühlte… Die Beweise waren allerdings etwas zu erdrückend.
Mit etwas Glück bleibt Australien mehr Banister-Intelligenz eventuell erspart: im Moment wird gerichtlich gegen sie ermittelt weil sie angeblich Aufkleber verteilt hatte: “halal funds terrorism” brüllten die weiß auf rot, und ihre Anhänger hatten sie in Brisbanes Supermärkten auf Fleischwaren und andere Produkte geklebt. Das Verfahren steht noch aus, aber mit Vorstrafe darf sie nicht ins Parlament. phhhh.
Dies waren Stephanie Banisters Aufkleber. Dank derer könnte Australien von ihr verschont werden.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
 Les bons citoyens von Betchat haben gewählt. Mit überwältigender Mehrheit links. Das hatte ich auch nicht anders erwartet. Und doch hat auch hier Marine le Pen die Zahl der Stimmen des rechtsradikalen Front National FN im Vergleich zu 2007 fast verdoppeln können – auf 31. Das entspricht 12,55% der abgegebenen Stimmen. Direkt hinter Nicolas Sarkozy, der 37 Wähler überzeugte.
Les bons citoyens von Betchat haben gewählt. Mit überwältigender Mehrheit links. Das hatte ich auch nicht anders erwartet. Und doch hat auch hier Marine le Pen die Zahl der Stimmen des rechtsradikalen Front National FN im Vergleich zu 2007 fast verdoppeln können – auf 31. Das entspricht 12,55% der abgegebenen Stimmen. Direkt hinter Nicolas Sarkozy, der 37 Wähler überzeugte.
Wer also sind diese 31, die auf dieser gefährlich erscheinenden Marine-Welle schwimmen? Nur wenige geben in einer so übersichtlichen Gemeinde mit rund 290 Wahlberechtigten, wo jeder jeden kennt, gerne offen zu, FN zu wählen. Von einigen weiß ich es: Zum Beispiel ein älteres Ehepaar, ganz durchschnittliche, freundliche Leute, die einen zweiten Wohnsitz in Toulouse haben. Dort in einem Viertel, in das über die Jahre immer mehr Nordafrikaner oder Franzosen mit maghrebinischer Herkunft gezogen sind. Sie sagen, das Leben dort habe sich total verändert. Die Kriminalitätsrate sei drastisch gestiegen, wenn es dunkel werde, trauten sie sich nicht mehr auf die Straße. Dieses Rentnerpaar sehnt sich nach den guten alten Zeiten, als man überall in Toulouse noch zu jeder Tages- und Nachtzeit sorgenfrei herumspazieren und in den Straßencafés sitzen konnte. Deshalb gehören sie zur Fraktion „Ausländer raus – Frankreich den Franzosen“.
Diese Fraktion verkörpern inzwischen sowohl Marine Le Pen als auch Nicolas Sarkozy. Doch Le Pen spricht die Sprache des einfachen Volkes, Sarkozy nicht. Wenn ich mit meinen Nachbarn über Alltägliches rede, Probleme die sie haben, ihre Wünsche, Sehnsüchte, dann denke ich oft in diesen Tagen: Könnte gut sein, dass sie Le Pen wählen. Dabei sind sie weder besonders radikal, noch wollen sie einen Polizeistaat. Auch gegen Juden haben sie in der Regel nichts. Wenn es um Araber und Muslime geht, haben sie allerdings größere Vorbehalte. Die Medien machen ihnen Angst vor diesen Leuten. Sie verstehen sie nicht. Irgendwie wäre es schon gut, wenn die alle wieder nach Hause gehen könnten.
Einige der Pensionäre hier auf dem Land haben auch persönlich schreckliche Erfahrungen im Algerien-Krieg machen müssen. Das haben sie nicht vergessen, selbst wenn sie auf Nachfrage zähneknirschend zugeben, dass auch die Franzosen dort entsetzliche Gewalttaten verübt haben. Es war halt Krieg, heißt es dann unter einem tiefen Seufzer. Und Kriege sind immer schmutzige Angelegenheiten. Oder? Das Misstrauen ist geblieben. Auf diesem fruchtbaren Boden werden von der politischen Rechten sowie von zahlreichen französischen Medien Ängste gesät. Mit Erfolg.
So ist die Ausländer- oder vor allem die Araber-feindlichkeit – wie in Deutschland auf dem Lande auch – weit verbreitet in der Ariège. Die Mordserie von Mohamed Merah in Toulouse und Montauban hat dieses Gefühl noch verstärkt. Doch dies ist noch nicht die ganze Erklärung für die Sympathien für Le Pen in einem Teil Frankreichs, der traditionell rot ist. Viele Leute hier müssen hart für wenig Geld arbeiten. Sei es in der Landwirtschaft oder in der spärlich vorhandenen Industrie. Die meisten sind bescheiden, haben Angst vor einer unsicheren Zukunft, sie sehen, wie die staatlichen Sicherheiten, auf die sie sich mal verlassen konnten, zusammengestrichen werden.
Das prägt, bei aller Gelassenheit, die in dieser Gegend tonangebend ist, ein Lebensgefühl. Rückwärtsgewandt muss man es wohl nennen. Warum kann das Leben nicht mehr so sein wie es früher mal war? Als die Welt der Ariègois noch in Ordnung war. Als Betchat noch mehrere Handwerksbetriebe hatte, Geschäfte und ein Café. Heute gibt es nur noch eine Post, ein Bürgermeisteramt und eine Schule. Naja, und die Kirche mit Friedhof. Manchmal, aber nicht regelmäßig, wird hier noch eine Messe gelesen.
Es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Am liebsten so wie früher. Aber wie? Wehmütig erzählt mir mein Nachbar Dede, der in der Wachmannschaft von Charles de Gaulle in den 60er Jahren gedient hat, dass man damals Politikern noch glauben konnte. Insbesondere de Gaulle natürlich. So ein Übervater, strammer Franzose mit Rückgrat, hervorgegangen aus dem Widerstand gegen Hitler und das Vichy-Regime, das wäre was. Auf den konnte man stolz sein. Aber Sarkozy, Hollande oder Mélenchon dagegen…
Und die Übermutter, Marine le Pen? Sie macht vielen noch Angst. Jedoch weniger als ihr Vater. Die Tochter hat den Front salonfähiger gemacht. Ein weiterer Grund für den Stimmenzuwachs. Und sie spricht eben tatsächlich die Sprache der einfachen Leute, die sich irgendwie von der aktuellen politischen Elite in Paris nicht wirklich vertreten fühlt. In ihren eigenen Werten und Traditionen tief verwurzelt und doch im heutigen politischen Zirkus orientierungslos – diese Beschreibung trifft wohl auf viele zu, die in Betchat am Sonntag Marine Le Pen gewählt haben. Ob sie am 6. Mai Hollande oder Sarkozy oder gar nicht wählen werden? Es werden noch Wetten angenommen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
 Beim Fotografieren seiner Ausstellung „Moscheen in Deutschland“ hat der Stuttgarter Architektur-Fotografen Wilfried Dechau viel über die islamische Minderheit in seiner Heimat gelernt. Vor allem viele kleine Details, die man eben nur erfährt, wenn man den Alltag von Muslimen miterlebt. In der indonesischen Studentenstadt Jogjakarta, wo das Goethe-Institut seine Bilder im März im Wandelgang der Moschee der größten islamischen Universität ausgestellt hat, wollte er nun einen Umkehreffekt erreichen: Drei Tage lang ließ er Studenten im Rahmen eines Workshops Kirchen und Tempel fotografieren. Dabei ging es zwar natürlich hauptsächlich um Tricks und Kniffe der Architekturfotografie, aber nicht ganz nebensächlich auch um die Vermittlung der religiösen und kulturellen Vielfalt im Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Das Experiment funktionierte tatsächlich und die Studenten stießen in den Gebetshäusern der ihnen zum Teil unbekannten Religionen auf viele Details, die sie interessierten oder sogar berührten – und die sie in zum Teil beeindruckenden Bildern festhielten. Dennoch endeten die Exkursionen zu den Kirchen und Tempeln jedes Mal mit der Suche nach einer Moschee: Die Organisatoren hatten nicht bedacht, dass die muslimischen Teilnehmer bei aller interreligiösen Gruppenharmonie dennoch ihre Gebetszeiten einhalten wollen…
Beim Fotografieren seiner Ausstellung „Moscheen in Deutschland“ hat der Stuttgarter Architektur-Fotografen Wilfried Dechau viel über die islamische Minderheit in seiner Heimat gelernt. Vor allem viele kleine Details, die man eben nur erfährt, wenn man den Alltag von Muslimen miterlebt. In der indonesischen Studentenstadt Jogjakarta, wo das Goethe-Institut seine Bilder im März im Wandelgang der Moschee der größten islamischen Universität ausgestellt hat, wollte er nun einen Umkehreffekt erreichen: Drei Tage lang ließ er Studenten im Rahmen eines Workshops Kirchen und Tempel fotografieren. Dabei ging es zwar natürlich hauptsächlich um Tricks und Kniffe der Architekturfotografie, aber nicht ganz nebensächlich auch um die Vermittlung der religiösen und kulturellen Vielfalt im Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Das Experiment funktionierte tatsächlich und die Studenten stießen in den Gebetshäusern der ihnen zum Teil unbekannten Religionen auf viele Details, die sie interessierten oder sogar berührten – und die sie in zum Teil beeindruckenden Bildern festhielten. Dennoch endeten die Exkursionen zu den Kirchen und Tempeln jedes Mal mit der Suche nach einer Moschee: Die Organisatoren hatten nicht bedacht, dass die muslimischen Teilnehmer bei aller interreligiösen Gruppenharmonie dennoch ihre Gebetszeiten einhalten wollen…
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Plötzlich kämpfen alle für die Pressefreiheit – französische Politiker jeder Couleur preisen sie als „heiliges Recht“ der Franzosen. Richtig so. Ich meine, dieselben Politiker sollten ebenso auf die Barrikaden gehen, wenn staatliche Abhörskandale gegen französische Journalisten bekannt werden. Oder welche Pressefreiheit darf es bitteschön sein?
Der Aufschrei des Entsetzens gestern, nach dem abscheulichen Brandanschlag gegen den Redaktionssitz der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ in Paris, war ebenso absehbar wie ein Akt der Gewalt als Antwort auf das satirische Porträt des Propheten Mohammed auf der Titelseite der neusten Ausgabe. Als der Titel am Vortag publik wurde, war denen, die ein wenig Sensibilität gegenüber den Befindlichkeiten der islamistischen Szene und Kenntnis von der Engstirnigkeit ihrer extremen Anhänger haben, klar: Es wird Reaktionen geben. Und sie werden vermutlich mit Gewalt einhergehen.
Ob die Form der Auseinandersetzung von „Charlie Hebdo“ mit dem Wahlsieg der Islamisten-Partei Nahda in Tunesien und der Absichtserklärung des libyschen Übergangspremiers Mustafa Abdel Jalil, mehr Scharia-Elemente in der künftigen libyschen Rechtsprechung zu berücksichtigen, eine besonders intelligente war, sei dahingestellt. Unsere Pressefreiheit besagt schließlich nicht, dass nur kluge Meinungsäußerungen erlaubt sind. Und Satire umfasst erfahrungsgemäß ein sehr breites Spektrum zwischen „Dumm wie Bohnenstroh“ und intelligentem Witz. Egal für wie dumm man die Idee der Ausgabe „Charia hebdo“ hält, einen Brandanschlag auf die Redaktion rechtfertigt sie nicht. In einer aufgeklärten Gesellschaft sollte erlaubt sein, auch Religion und religiöse Figuren zu persiflieren. Und zwar die aller Religionen.
Das wird allerdings umso heikler, je aufgeheizter das Klima in einer Gesellschaft gegenüber dieser Religion ist. Leider herrscht in diesen Tagen nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland, Islamophobie. Die Reaktionen in der französischen Presse aber auch unter einigen Politikern nach dem Wahlsieg der tunesischen Islamisten muss man teilweise als hysterisch bezeichnen. Da war sofort die Rede vom Ende der Frauenrechte, ja gar vom Ende der Demokratie! Dabei hatte die Nahda-Partei gerade bei als sehr demokratisch-korrekt bewerteten Wahlen eine Mehrheit errungen.
Warum diese unbesonnenen Reaktionen? Politische Verbohrtheit? Dummheit? Oder nur Unkenntnis der politischen und gesellschaftlichen Realitäten eines Landes wie Tunesien? Die Gesellschaften in Tunesien, Ägypten und Libyen haben jahrzehntelang unter korrupten, selbstherrlichen und gesetzlosen Regimen gelitten. Die Menschen sehnen sich nach Recht und Ordnung. In diesem Kontext haben die so genannten „gemäßigten Islamisten“ die Aura konservativer Saubermänner, denen man am ehesten zutraut, nicht persönlichen Profit zu suchen und das Land zumindest einem Rechtsstaat nahe zu bringen. Die Tunesier haben sich mehrheitlich entschieden, Nahda eine Chance zu geben. Soll die Partei nun Flagge zeigen und man wird sehen, ob die Erwartungen der Wähler erfüllt werden oder ob die Islamisten sich abwirtschaften und dann hoffentlich abgewählt werden. Natürlich kann das schief gehen. Aber es ist vielleicht auch die einzige Chance, islamischem Extremismus das Wasser abzugraben.
Ähnliches gilt für den Fall Libyen. Dort wurde schließlich nicht das Scharia-Recht als einzig geltendes eingeführt. Mustafa Abdel Jalil erklärte Berichten zufolge lediglich in Benghazi: „Wir sind ein islamischer Staat“ und versprach die Gesetze zu ändern, die dem islamischen Recht widersprächen. So hat man sich das im Westen vielleicht nicht vorgestellt, als man die Nato-Flugzeuge de facto zum Sturz Gaddafis in den Einsatz schickte. Tatsache ist aber, dass die meisten Staaten mit muslimischer Mehrheit zumindest Elemente der Scharia in ihrer Rechtsprechung berücksichtigen. In manchen betrifft das nur persönliche Rechte, in anderen ist die Scharia eine Quelle der Gesetzgebung neben anderen. Oder sie ist die wichtigste Quelle der Gesetzgebung. Oder wir haben es gar mit Scharia-Recht zu tun, wie in Saudi-Arabien oder Iran.
Aber dass das Rechtssystem, das sich ein Staat gibt, von den religiösen Werten der Mehrheit der Bürger inspiriert ist, ist doch nicht ungewöhnlich. Das ist auch bei uns so, obwohl wir uns auf eine strikte Trennung von Kirche und Staat berufen. Denken wir zum Beispiel daran, wie schwer wir uns mit der Gleichberechtigung schwuler oder lesbischer Paare tun. Wichtig ist, dass die Rechte von Minderheiten geschützt werden. Und dass das Prinzip der Gleichberechtigung – auch der von Männern und Frauen – respektiert wird. Das Selbstbestimmungsrecht gehört ebenfalls in diesen Katalog. In diesem Sinne täten wir gut daran, den Ausgang freier, demokratischer Wahlen zu respektieren und abzuwarten, welche neue Lebensrealität die Tunesier, Ägypter und Libyer für sich gestalten möchten. Steigen wir von unserem hohen Ross herunter, hören wir auf uns als neue „Besserwessis“ zu gebärden, die glauben, sie wüssten, was für diese Menschen gut ist.
Einen Anschlag auf unser hohes Gut der Pressefreiheit wie den auf „Charlie Hebdo“ dürfen wir nicht akzeptieren. Aber wir sollten auch nicht wortlos zusehen, wie einige Politiker und Journalisten aber auch ganz normale Bürger ihn als Anlass für einen neuen Kreuzzug gegen den Islam missbrauchen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Der Ramadan kommt. Bald. Die Askese im islamischen Fastenmonat kündigt sich mit einem Frontalangriff auf alle Sinne an: Restaurants werben jetzt schon mit besonders günstigen Menüs zum Fastenbrechen, Moscheelautsprecher scheppern religiöse Popmusik in den Äther und riesige Plakate preisen die diesjährigen Ramadan-Seifenopern im Fernsehen an. Vor allem Essen wird in diesen Wochen zu einem der wichtigsten Gesprächsthemen der Indonesier genauso wie die Lebensmittelpreise, die wie in jedem Jahr schwindelerregend ansteigen.
Ähnlich wie bei uns an Weihnachten beschleicht einen das Gefühl, dass die Vorbereitungen für die Fastenzeit (oder besser Festzeit?) jedes Jahr ein bisschen früher anfangen und ein bisschen kommerzieller werden. Dazu muss man wissen, dass das Idul-Fitri-Fest am Ende des Ramadan für die Indonesier der wichtigste Feiertag des Jahres ist – anders als in anderen islamischen Ländern, in denen das Opferfest Idul Adha am größten gefeiert wird. Noch bevor das Fasten überhaupt beginnt, sind alle Einkaufszentren mit Ramadan-Dekor geschmückt, ergeht sich die Werbung in Tipps für die beste, feierlichste, gesündeste Art des Fastenbrechens und der Nachwuchs lernt in der Schule oder im Kindergarten die passenden Gebete und Lieder dazu. Mit asketischer Zurückhaltung und religiöser Selbstfindung hat das Ganze meist so wenig zu tun wie die Adventszeit in Deutschland.
Wer dem zu erwarteten Rummel an Idul Fitri entkommen will, sollte früh buchen: Zug- und Flugtickets zu Beginn der landesweiten Ferien am Ende des Ramadan sind einen Monat vorher schon unerschwinglich bis ausverkauft. Wenn die eine Hälfte der 240 Millionen Indonesier (nämlich die Stadtbevölkerung) die andere Hälfte in ihren Heimatregionen besuchen will, bleibt nicht mehr viel Platz – sei es in Bussen, Zügen, Flugzeugen oder Fähren. Wer kein Ticket ergattert, packt seine Lieben ins Auto und drängelt sich oft tagelang über völlig verstopfte Landstraßen bis ins Heimatdorf – nicht selten in einem gemieteten Vehikel, damit die Familie daheim beeindruckt ist vom Erfolg der Fortgezogenen. Dazu gehören natürlich jede Menge Geschenke und natürlich die entsprechende Festtagskleidung.
Um dies alles finanzieren zu können, stürzen sich viele Indonesier im Fastenmonat in immense Unkosten. In keiner anderen Jahreszeit wird so viel eingebrochen, gestohlen und geschmiert. Selbst die Wahrscheinlichkeit, auf der Straße in eine Verkehrskontrolle zu geraten, steigt enorm, je näher Idul Fitri rückt: Auch Polizisten wollen feiern.
Angesichts all dieser Obstakel ist der beste Weg, den Ramadan zu begehen, daher tatsächlich, zu Hause zu bleiben, den Fernseher auszuschalten und: zu fasten.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Die westlichen Demokratien haben sich bei der tunesischen wie der ägyptischen Revolution gründlich blamiert. Sie hinkten hinter den Ereignissen her, wanden sich in Schmerzen mit vorsichtigen Statements. Ging es doch schließlich darum, den Diktatoren und Unterdrückern die Unterstützung zu entziehen, die sie seit Jahrzehnten in ihren Palästen gehalten hatte. Völlig ungeachtet der Tatsache, dass man in politischen Sonntagsreden immer mehr Demokratie im Nahen Osten forderte. Aber das versteht sich von selbst.
Als es gar nicht mehr anders ging, forderten US-Präsident Barack Obama und seine europäischen Mitläufer einen schnellen aber geordneten Übergang zu einer wirklich demokratischen Regierungsform. Aha. Damit behalten sie sich vor, darüber zu urteilen., was ‘wirklich demokratisch’ ist. Und im gleichen Atemzug drängt man auf die Einhaltung internationaler Verträge und Verpflichtungen. Da nämlich liegt, wenn es um den Nahen Osten geht, für die meisten westlichen Politiker der Hase im Pfeffer: Fast alles darf passieren, aber die beiden Friedensverträge mit Israel (mit Ägypten und Jordanien) dürfen nicht angetastet werden. Außerdem dürfen keine Islamisten an die Macht kommen, wobei am liebsten alle islamistischen Gruppierungen in einen großen Topf geworfen werden. Wie man es in Washington, Berlin und Paris damit hält, wenn demokratische Wahlen Islamisten an die Macht bringen, das haben wir beim Urnengang in den Palästinensergebieten 2006 gesehen. Als die Hamas den Sieg davon trug, brach man schlicht die Beziehungen mit der von ihr geführten Regierung ab.
Die westlichen Regierungen – nicht nur die amerikanische – haben in der arabischen Welt schon längst ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt. Die Menschen in der Region verstehen, dass es nicht um Werte wie Demokratie, Selbstbestimmung und Freiheit geht sondern um politische Interessen. Vornehmlich um solche, die sich mit israelischen Interessen decken. Auch wenn man in vielen Fällen trefflich darüber diskutieren kann, ob sich diese Interessen tatsächlich decken. Oder ob wir uns nicht selbst ins Knie schießen, gerade weil wir dazu tendieren, die Region ausschließlich durch die israelische Brille betrachten.
Auch deshalb können die Ägypter auf gute Ratschläge aus dem Westen derzeit verzichten. Ihnen ist nicht entgangen, dass Washingtons Lieblingskandidat für die Nachfolge Mubaraks sein Geheimdienstchef Suleiman war. Also jemand, der mit Leib und Seele für das alte System stand und steht. Die Armee ist nun die zweitbeste Wahl, arbeitet ihre Führung doch sehr eng mit amerikanischen Militärs zusammen, die eine Finanzhilfe von 1,3 Milliarden US-Dollar jährlich beisteuern. In dem Preis dürfte inbegriffen sein, dass keine Politik erlaubt wird, die den ohnehin kalten Frieden mit Israel einfrieren könnte.
Interessant wird es, wenn eine wirklich demokratische zivile Regierung in Kairo an der Macht ist. Ihr werden vermutlich die ägyptischen Moslembrüder angehören, auch wenn die Menschen auf dem Tahrir-Platz deutlich gemacht haben, dass die Islamisten keine Mehrheit im Land haben.Ein weiterer Schleier ist gefallen: Die Alternative zu autokratischen oder diktatorischen Systemen im Nahen Osten heißt nicht automatisch Chaos und Islamismus. Es dürfte den Regierenden in Washington und Berlin in Zukunft schwer fallen, mit dieser Gleichung zu argumentieren, wenn es um die Unterstützung repressiver Regime in der Region geht, die Menschenrechte verachten aber Stabilität und Kampf gegen Terrorismus versprechen.
Unsere westlichen politischen Moralapostel stehen plötzlich ohne Kleider da. Sieht ganz so aus, als stünden sie auf der Verliererseite nach den erfolgreichen Volksaufständen in Tunis und Kairo. Gemeinsam übrigens mit ihren Erz-Feinden, den islamischen Extremisten aus der Al Qaeda-Ecke. Denn der Sieg der friedfertigen Menschen gegen ein brutales, vom Westen unterstütztes System, nimmt diesen Terroristen den Wind aus den Segeln. Die Jugendlichen, die auf dem Tahrir-Platz in Kairo den Sturz Mubaraks gefeiert haben, haben es nicht mehr nötig, sich solchen Bewegungen aus Protest oder dem Gefühl der Ohnmacht anzuschließen. Sie haben sich selbst befreit und ermächtigt, sie haben ihren Stolz und ihre Menschenwürde zurück erobert.
Nachdem ich mehr 15 Jahre lang dem politischen Stillstand, der Demütigung und der Entmündigung der Menschen in der Region zugesehen habe, habe ich nun wieder Hoffnung. Auch wenn wir alle wissen, dass die Revolutionen noch nicht gewonnen oder vollendet sind. Aber es wäre schön, noch mehr solch befreite, lachende oder vor Freude weinende Gesichter in Arabien zu sehen. Die Sehnsucht ist geweckt, hoffentlich wird sie nicht in Blutvergießen ertränkt.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
„Selamat Natal – Frohe Weihnachten und Friede und Wohlstand für uns alle“ – diese Wünsche schickten mir in vielfacher Form Freunde aus Indonesien ins kalte Deutschland. Nicht etwa Christen, sondern vor allem muslimische Bekannte bedachten uns mit Rundmails und individuellen SMS.
Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt und ja: Es findet eine schleichende Islamisierung statt, die allen anderen Religionsanhängern in dem Vielvölkerstaat unheimlich ist. Dennoch ist Indonesien immer noch ein säkularer Staat, in dem die wichtigsten Feiertage der großen, anerkannten Religionen zugleich nationale Feiertage sind. So bleiben Schulen und Behörden nicht nur am muslimischen Opferfest und an Weihnachten geschlossen, sondern auch am buddhistischen oder hinduistischen Neujahrsfest.
Das ist mehr religiöse Toleranz als wir zum Beispiel in Deutschland zeigen: Der Anteil der muslimischen Bevölkerung bei uns ist größer als der von Buddhisten und Hindus in Indonesien. Dennoch wünscht hier kaum ein Nicht-Muslim alles Gute zum Idul-Fitri-Fest am Ende des Ramadan, geschweige denn bekommen die muslimischen Bürger für ihre religiösen Feierlichkeiten frei.
In dieser angeblichen Zeit der Besinnung sollten wir einmal mehr über unseren Tellerrand und die geballte westliche Angst vor dem Islam hinausschauen und erkennen, dass es auch im anderen Teil der Welt tolerante und offene Menschen gibt, an denen wir uns ein Beispiel nehmen können.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Die Sarrazin-Debatte ist in full swing. Es ist weder möglich, noch nötig, dem Ganzen einen Aspekt hinzuzufügen. Die Debatte ist da, wenn ich morgens das Radio anschalte, sie ist immer noch da, wenn ich am Nachmittag zur Zeitung greife, und sie hat nicht aufgehört, wenn ich abends in die Röhre gucke, sollte das mal vorkommen.
Ich bin mir nicht sicher, ob Sarrazin ein Rassist ist. Ich halte ihn für einen Demagogen mit faschistoiden Gedankenansätzen. Oder wie soll man es sonst nennen, wenn ganze Bevölkerungsgruppen – unabhängig von dem, was der oder die Einzelne tut oder lässt – in die Tonne getreten werden?
Das Gute an der Debatte: Die politische und mediale Öffentlichkeit weist, quer durch alle Weltanschauungen, Sarrazins Sündenbockthesen entschieden zurück. Das hat was mit dem Immunsystem einer Gesellschaft zu tun und stimmt leicht optimistisch, vielleicht sind wir Brandstiftern ja gar nicht hilflos ausgeliefert. Die wenigen namhaften Befürworter, die ihm zur Seite springen, verteidigen ihn ähnlich schrill.
Dennoch wird das Phänomen Sarrazin nicht mehr verschwinden. Die Debatte findet in jenem Schatten statt, den zukünftige Verteilungskämpfe bereits jetzt auf uns werfen. Oder besser formuliert:
»Es werden ganze Klassen, Schichten und Weltanschauungen ausgesondert und abgewertet: Die Muslime. Die 68er. Die Arbeitslosen. Die armen Familien. Die Alleinerziehenden. Man hackt mit ein paar Phrasen unterhalb, seitlich und über der vom Abstieg bedrohten Mittelschicht die nicht genehmen Gruppen weg. Übrig bleibt letztlich der spiessige Kleinbürger voller Angst, man könnte ihm auch seinen kleinen Status wegnehmen und zu solchen Gruppen rechnen. Gruppen des sozialen Prestigeverlustes, Gruppen, vor denen er sich fürchtet, weil sie nicht seiner und der Herrschenden Norm entsprechen. Gruppen, mit denen man den Mittelstand dazu bringt, die Herrschaft der Spalter von Oben zu lieben.«
Den kompletten Text von Don Alphonso aus seinem F.A.Z.-Blog »Stützen der Gesellschaft« gibt es hier! Er schrieb ihn, mit ausdrücklichem Bezug zu Sarrazin, bereits vor fast einem Jahr.
Den besten Kommentar zur Debatte hat, wie ich finde, Christoph Schlingensief gegeben, zweieinhalb Monate vor seinem Tod und fast drei Monate vor dem Eintreffen des aktuellen Debatten-Tsunamis. Sarrazins Phantasien, konsequenter und absurder als bei Sarrazin selber, so gespenstisch, verstörend, beklemmend, wie das nur Kunst hinkriegt. Zu Schlingensiefs kurzem Video hier entlang!
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Das »journalistische Desaster«, wie Jörg Lau von der ZEIT es in einem Gastvortrag nannte, begann am 5. Juni und nahm in den Wochen danach seinen ungebremsten Lauf. Es ist einer jener Wahrnehmungsunfälle, die im Stimmengewirr unserer postmodernen Medienwelt inzwischen leider all zu oft die Normalität sind. Den Anfang macht eine kurze, zweiseitige Zusammenfassung einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN). Ihr widmen sich an jenem 5. Juni zuerst die Süddeutsche Zeitung und dann die Nachrichtenagenturen.
In der KFN-Studie geht es auch und unter anderem um den Zusammenhang zwischen der Religiosität junger Muslime in Deutschland und ihrer Bereitschaft zu Gewalt. Die zweiseitige Zusammenfassung behauptet: »Für junge Muslime geht … die zunehmende Bindung an ihre Religion mit einem Anstieg der Gewalt einher.«
Wenn das keine Schlagzeile ist! »Die Faust zum Gebet«, überschreibt die Süddeutsche Zeitung ihren Beitrag, gefolgt vom Chor anderer Boulevard- und Qualitätszeitungen: »Allah macht hart«, »Jung, muslimisch, brutal«, »Junge Muslime, je gläubiger, desto brutaler« usw. usf. Im Artikel der Süddeutschen behauptet Christian Pfeiffer, Direktor des KFN, zwischen muslimischer Religiosität und Gewaltbereitschaft gebe es einen »signifikanten Zusammenhang«.
Es ist das Verdienst von bildblog.de, den kompletten Text der Studie einfach mal ganz gelesen zu haben. Dort findet sich nämlich dieser »signifikante Zusammenhang« von muslimischer Religiosität und Gewalt gar nicht. Er ist allenfalls sehr klein, und die Studie begründet ihn mit allem möglichen, nur nicht mit Religion. Im Gegenteil: Sie belegt, »dass diese (leicht – J. S.) erhöhte Gewaltbereitschaft weitestgehend auf andere Belastungsfaktoren zurückzuführen ist.« Es sei, heißt es in der Studie weiter, »bei islamischen Jugendlichen von keinem unmittelbaren Zusammenhang … zwischen der Religiosität und der Gewaltdelinquenz auszugehen.«
Bildblog.de weist auf diesen Widerspruch am 13. Juni hin und lässt sich von Pfeiffer erklären, er sei falsch zitiert worden. Zu spät, die Schlagzeilenmaschine lief da bereits seit einer Woche rund, siehe oben. Schwer zu sagen, woran diese mediale Entgleisung nun genau lag, ob zum Beispiel Pfeiffer so sehr nach Publicity für sein Institut giert, dass es ihm »offenbar lieber ist, falsch zitiert zu werden als gar nicht« (Jörg Lau). Darüber kann nur spekuliert werden. Sicher ist: Die deutsche (Medien-) Öffentlichkeit scheint auf den Kurzschluss »junge Muslime gleich Gewalt« nur gewartet zu haben. Wer muss da schon ganze Studien lesen.
Soweit ich weiß, haben sich die meisten Blätter später nicht nur nicht korrigiert, sondern basteln auch weiterhin an diesem Stigma, noch Wochen danach, wie etwa der Wiesbadener Kurier oder Spiegel Online. Eine Ausnahme bildet die österreichische Zeitung Die Presse, die sich für den Beitrag »Gewissenloses Islam-Bashing« die Mühe macht, auch mal in den ersten Teil der KFN-Studie aus dem Jahre 2009 zu gucken. Dort werde belegt, dass muslimische Migranten gar nicht gewalttätiger seien als Migranten aus anderen Kulturkreisen.
Aber solch eine Schlagzeile wäre leider längst nicht so sexy wie »Gläubige Muslime sind deutlich gewaltbereiter«.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Der Anfang Juli in Beirut verstorbene schiitische Großajatollah Mohammed Hussein Fadlallah hat uns über seinen Tod hinaus noch einige Lehren mit auf den Weg gegeben. Nicht zuletzt, dass es mit der Meinungsfreiheit auch im Westen nicht sehr weit her ist, wenn es um eine berühmte und umstrittene Figur wie Fadlallah geht. Zudem eine, welche die israelische, die amerikanische und die britische Regierung als „Erz-Terroristen“ gebrandmarkt haben.
Die amerikanisch-libanesische CNN-Nahost-Spezialistin Octavia Nasr hat ihr Tweet zu Fadlallahs Tod ihren Job gekostet. Die britische Botschafterin Francis Guy, die den Großajatollah in ihrem diplomatischen Blog aus Beirut würdigte, erhielt eine schroffe Rüge aus London. Ihr Blogeintrag wurde aus dem Netz verbannt.
Nun kann man den beiden ausgezeichneten Nahostkennern keine Naivität vorwerfen. Vielleicht hätte Nasr nicht gerade einen Tweet mit 140 Zeichen-Begrenzung wählen sollen, um ihren Gefühlen über den Tod einer so komplexen Person wie Fadlallah Ausdruck zu verleihen. Dächte man auch nur einen kurzen Moment nach, könnte man darauf kommen, dass das nicht gut gehen kann. Andererseits wissen wir auch, wie hoch der Druck einiger großer Medienunternehmen auf ihre Mitarbeiter ist, vor allem im TV-Bereich, zu tweeten und zu bloggen. Bei manchen ist es schon Einstellungsvoraussetzung, hört man. Der Wahnsinn in dieser Welt hat viele Gesichter!
Beiden Äußerung zu Fadlallahs Tod ist eines gemein: Sie drückten Respekt für den verstorbenen schiitischen Großajatollah aus, der in vielen Medien weiterhin fälschlich als geistlicher Führer oder ehemaliger geistlicher Führer der Hisbollah beschrieben wird. Das kann man sicher so nicht sagen, obwohl Fadlallah Sympathien und teilweise offene Unterstützung für einige politische Sichtweisen und Taten der Hisbollah geäußert hat und beide sicherlich den Kampf gegen Israel und eine feindliche Gesinnung gegenüber den USA teilten. Die einzig wirklich gut recherchierte Würdigung Fadlallahs, die ich gelesen habe, stand übrigens im US-Magazin Foreign Policy.
Octovia Nasr musste ihre 20jährige Karriere bei CNN beenden wegen des Satzes: Fadlallah ist einer der Hisbollah-Giganten, die ich sehr respektiere. Darauf erhielt sie sofort wütende Reaktionen, unter anderem vom Simon Wiesenthal Center in den USA, das sie aufforderte, sich sofort bei all jenen Hisbollah-Opfern zu entschuldigen, deren Angehörige ihre Trauer über den Tod des Hisbollah-Giganten nicht teilen könnten. Kurz darauf entschied CNN, dass Nasrs Glaubwürdigkeit kompromittiert war, obwohl sie sich entschuldigt hatte und ihren eigenen Tweet als Fehleinschätzung zurückgezogen hatte. So schnell kann eine Karriere zu Ende gehen. Das besorgniserregende daran ist – ganz egal ob man Octavia Nasrs Einschätzungen zum Nahen Osten teil oder nicht – dass sie für CNN unhaltbar wurde, obwohl ihre Vorgesetzten wussten, dass sie eine durchaus differenzierte Einstellung zu Fadlallah und zur Hisbollah hatte, die sie immerhin 20 Jahre lang über den Sender gebracht hatte.
Der Fall der britischen Botschafterin Francis Guy liegt ganz ähnlich – obwohl sie glücklicherweise nicht gleich aus Beirut abgezogen wurde und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Denn sie gehört zu den großen Kennern der Region in der westlichen Botschafterclique hier, sie wohltuend ist ehrlich, aufrichtig und nicht immer so entsetzlich diplomatisch. Guy hatte in ihrem Blog geschrieben, der Tod des Ajatollahs habe den Libanon ärmer gemacht. „Wenn man ihn besuchte, konnte man sicher sein, eine ernsthafte und respektvolle Auseinandersetzung zu erleben und man wusste, dass man sich als bessere Person fühlen würde, wenn man ihn verließ. Das ist für mich der Effekt eines wirklichen religiösen Mannes, dass er einen tiefen Eindruck bei jedem hinterlässt, der ihn trifft, ganz egal welchen Glaubens diese Person ist.“ Ein Sprecher der israelischen Regierung schrie „Skandal“ und das britische Außenministerium wand sich in Schmerzen. Es sei eine persönliche Meinung gewesen, hieß es aus London, die nicht der Regierungseinschätzung entspreche. Während das Foreign Office Fadlallahs progressive Ansichten zu Frauenrechten und dem inter-religiösen Dialog begrüße, gebe es auch tiefe Meinungsverschiedenheiten, vor allem wegen seiner Befürwortung von Attacken gegen Israel. Guy schrieb einen Entschuldigungsblog, in dem sie ihre Äußerungen zu Fadlallah mutiger Weise nicht zurücknahm. Aber, in dem sie sich klar von jeder Form (sic!) des Terrorismus distanzierte und in dem sie bedauerte, dass sie möglicherweise die Gefühle einiger ihrer Leser verletzt habe. Das sei nicht ihre Absicht gewesen.
Was lernen wir daraus? Dass Meinungsfreiheit in unserer westlichen Welt bei manchen Themen ganz engen Grenzen unterworfen ist, selbst, wenn man sehr differenziert ist. Sympathie für einen umstrittenen Menschen, vor allem islamischen Glaubens, den Israel und die USA als Erz-Feind ausgemacht haben – sei das nun berechtigt oder unberechtigt – kann und darf man nicht ungestraft äußern. Solche Einschätzungen werden im Zweifelsfalle nicht einmal diskutiert. Wie im Falle Octavia Nasrs heißt es lieber gleich „Kopf ab“. Ob das der Kultur einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, von der ich weiterhin träume, dient, wage ich zu bezweifeln.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Stellen Sie sich vor, Ihr Laptop wird gestohlen. Nicht nur, dass all Ihre darauf gespeicherten Arbeitsdaten weg sind – nein, dummerweise finden sich dort auch noch ein paar ziemlich private Filmchen, die Sie beim Sex mit Ihrer Freundin zeigen. Und mit ihrer Ex-Freundin. Noch pikanter wird die Geschichte dadurch, dass Sie einer der erfolgreichsten Sänger in einem musikverrückten Land mit 240 Millionen Einwohnern sind. Und Ihre Freundin eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen. Genauso wie die Ex-Freundin. Und ein paar Monate später tauchen diese Videos auf einmal bei Youtube auf…
Genau dies soll dem Leadsänger der indonesischen Popband Peterpan geschehen sein – der zugegebenermaßen auch ohne Privatvideo eine ziemlich sexy Erscheinung abgibt. Er jedoch, Künstlername Ariel, bestreitet genauso wie seine Liebschaften, dass sie auf den besagten Filmchen zu sehen seien. Deswegen lautete die offizielle Sprachregelung bislang „Personen, die Ariel etc. ähnlich sehen“.
Kein Grund für die Moralapostel im Land, sich zurückzuhalten: Politiker islamischer Parteien wittern die Chance, zum ersten Mal ein umstrittenes Antipornographiegesetz in einem prominenten Fall anzuwenden und einige Bürgermeister haben bereits Auftrittsverbote für Peterpan in ihren Städten angekündigt. Eine ganz neue Wendung nahm der Fall, als vor einigen Tagen Kommunikationsminister Tifatul Sembiring von der islamischen PKS-Partei einen Vergleich mit Jesus Christus zog: Die Frage, ob Ariel und Co. oder nur ähnlich aussehende Doubles auf den Videos zu sehen seien, sei so ähnlich wie die Debatte zwischen Christen und Muslimen, ob Jesus selbst oder nur ein ähnlich aussehender Mann gekreuzigt worden sei. Immerhin hat der Minister es mit dieser Bemerkung geschafft, auch diejenigen Bürger und Intellektuellen aufzurütteln, die sich bislang nicht für die auf Tausenden von Handys kursierenden Sex-Filmchen interessiert hatten.
Die öffentliche Diskussion dreht sich nun vor allem darum, ob Minister Sembiring nicht trotz seines viel genutzten Twitter-Accounts etwas Nachhilfe in Kommunikation benötigt. Und ob Ariel Peterpan, der mittlerweile von der Polizei festgenommen wurde, im übertragenen Sinne gekreuzigt werden soll – sozusagen als Märtyrer im Sinne der Gegner des Antipornographiegesetzes. Und ob der ganze „Peterporn“-Skandal nicht vielleicht doch nur dazu dient, von einigen hochkarätigen Korruptionsskandalen abzulenken, in die nicht nur diverse, ach so moralische Politiker, sondern auch die Polizei selbst verwickelt sind…