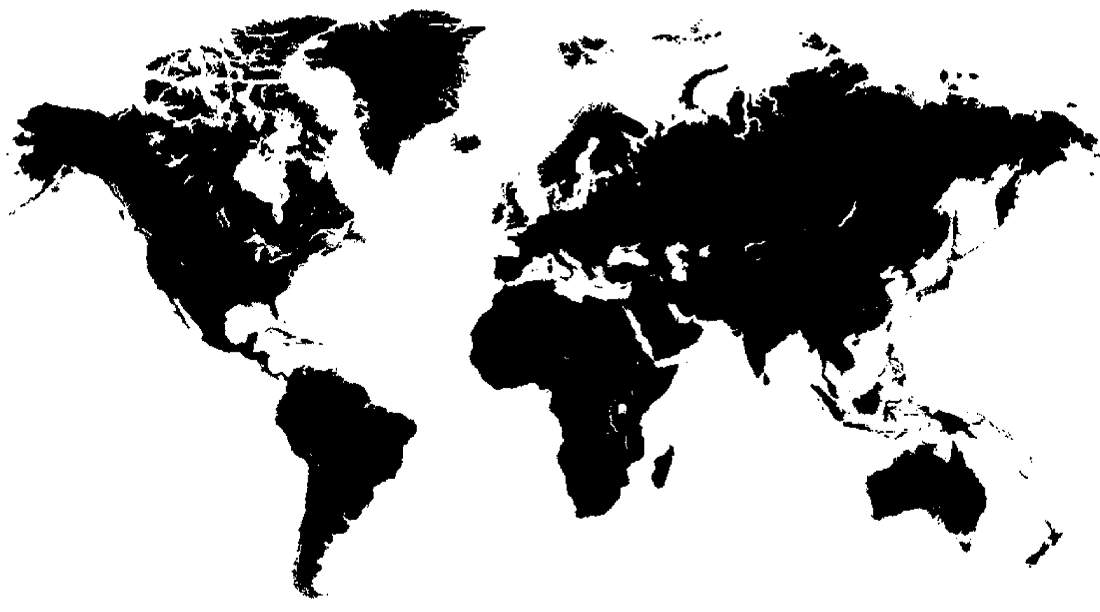Theresa Breuer für Vogue, 30. August 2022
AfghanistanVogue_2022_08_30-1.pdf
Shogufa Bayat ist keine Frau, die schnell ihren Mut verliert. Die 22-jährige Afghanin ist mit dem Fahrrad durch Kabul gefahren, obwohl sie von Männern dafür angespuckt wurde. Sie ist zur Universität gegangen, obwohl ihr Vater es verbieten wollte. Und sie ist auf Berge geklettert, obwohl Jungs sie dabei mit Steinen beworfen haben. Menschen wie Shogufa waren der Grund, warum ich nach Afghanistan gezogen bin. 2017 hatte ich von einer Gruppe junger Frauen gehört, die den höchsten Berg Afghanistans besteigen wollte. Noch nie hatte eine Afghanin auf dem 7500 Meter hohen Gipfel gestanden. Nicht wegen der Höhe. Sondern weil es bisher keine afghanischen Bergsteigerinnen gegeben hatte. Dass Frauen Sport treiben, war in Afghanistan tabu. Shogufa und ihr Team wollten nicht nur sich selbst herausfordern, sondern die Gesellschaft. „Wir wollen zeigen, dass Frauen genauso stark sind wie Männer“, sagten sie immer wieder. Zwei Jahre lang habe ich die Bergsteigerinnen begleitet, um einen Film über ihr Vorhaben zu drehen. Mit jedem Monat erschien es mir wahnsinniger. Die meisten Mädchen im Team, alle zwischen 15 und 20 Jahren, hatten in ihrem Leben noch nie Sport getrieben. Selbst im verhältnismäßig liberalen Kabul waren ihre Trainingsmöglichkeiten begrenzt. Im Freien wurden sie beschimpft und angegriffen. Im Fitnessstudio gab es oft keinen Strom. Dazu war Kabul eine der gefährlichsten Städte der Welt. Jede Woche starben Menschen bei Anschlägen, auch Verwandte der Mädchen und Bekannte von mir. Als ich eine Bergsteigerin zu der Beerdigung ihres besten Freundes begleitet habe, der bei einem Terrorangriff ums Leben gekommen war, sagte sie zu mir: „Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, frage ich mich, ob ich den heutigen Tag überleben werde.“
Die Kämpfe im eigenen Zuhause waren nicht weniger gefährlich. Einmal habe ich erlebt, wie ein Bruder zu seiner Schwester sagte, dass er sie umbringen werde, wenn sie nicht mit dem Bergsteigen aufhöre. Ein anderes Mädchen erzählte mir verzweifelt, dass ihr Vater sie dazu dränge, mit dem Bergsteigen aufzuhören, weil der Weg zum Training so gefährlich sei. Als sie erwiderte, dass ihr Bruder doch auch zur Universität gehen dürfe, ließ er das nicht gelten. Wenn sie, seine Tochter, bei einem Anschlag sterben würde, könnten Männer ihre nackten Leichenteile auf der Straße sehen. Das würde Schande über die Familie bringen. Nicht alle im Team haben dem Druck standgehalten. Einige Mädchen sind von heute auf morgen ohne Begründung nicht mehr zum Training erschienen. Andere haben dafür umso hartnäckiger weitergemacht. Sie haben daran geglaubt, etwas verändern zu können in ihrem Land. Bis zum 15. August 2021, als die Taliban in Kabul einmarschierten und ihre Hoffnung in nackte Angst umschlug.
Als die Taliban in Kabul einmarschierten
Obwohl die radikalen Islamisten in den Wochen zuvor in einer Blitzoffensive Provinz um Provinz eingenommen hatten, gingen Experten noch immer davon aus, dass die afghanische Hauptstadt frühestens in einigen Wochen, eher Monaten fallen würde. Auf das Entsetzen folgte Chaos. Die internationalen Truppen zogen sich hektisch zurück. Der afghanische Präsident flüchtete im Helikopter ins Ausland. In der Bevölkerung brach Panik aus. Und mich rief mit zitternder Stimme Shogufa an. Sie sollte nicht die Einzige bleiben. Jede Minute wurden es mehr, bis mein Telefon ununterbrochen klingelte. Freund:innen, Bekannte und Menschen, denen ich noch nie begegnet war, riefen aus Afghanistan an, schrieben auf Facebook, Instagram, WhatsApp. Hunderte Nachrichten mit immer demselben Inhalt: Bitte hilf mir.
Am Tag vor der Machtübernahme hatte ich überlegt, was ich für meine Freundinnen in Afghanistan tun könnte, bevor die Taliban das Land eroberten. Dass es passieren würde, war inzwischen klar. Die Frage war nur, wann. Klar war auch, dass Deutschland nur Afghan:innen evakuieren würde, die als Ortskräfte gearbeitet hatten, etwa als Übersetzer:innen für die Bundeswehr. Jurist:innen, Journalist:innen, Menschenrechtsaktivist:innen und Sportler:innen waren nicht bedacht worden. Frauen und Männer, die sich gegen die Ideologie der Taliban gestellt, für Demokratie und Menschenrechte gekämpft hatten, fürchteten jetzt um ihr Leben. In meiner Hilflosigkeit rief ich einen Freund an, der sich mit außergewöhnlichen Missionen auskennt. Ruben Neugebauer hat die Seenotrettungsorganisation Sea-Watch gegründet, auch er hatte Freund:innen in Afghanistan. Fassungslos über die Tatenlosigkeit der deutschen Regierung, schlug er vor, dass wir doch ein Flugzeug chartern könnten. Für die, die nicht evakuiert werden sollten. Für Menschen wie Shogufa.
Keine 24 Stunden später standen die Taliban in Kabul und wir vor einer Entscheidung. Während Bilder um die Welt gingen, die Zehntausende Afghan:innen am Flughafen Kabul zeigten, verzweifelte Menschen, die sich an Flugzeuge klammerten und in den Tod stürzten, beschlossen wir, zu handeln. Mit befreundeten Aktivist:innen und Journalist:innen gründeten wir die Kabul Luftbrücke, ein Team von zehn Leuten, alle Aktionen finanziert von Spenden. Zwei Wochen lang kämpften wir Tag und Nacht dafür, gefährdete Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Am Ende gelang es uns, 189 Menschen in Sicherheit zu bringen. Tage nachdem die Deutschen abgezogen waren.
Einen Tag später, am 30. August 2021, zogen auch die USA und die letzten internationalen Streitkräfte ab. Als die Taliban am 31. August über das ganze Land herrschten, geschah etwas Seltsames. Ruhe kehrte ein. 20 Jahre Krieg und Terror schienen auf einen Schlag vorbei zu sein. In den kommenden Monaten mehrten sich zwar Berichte von Hausdurchsuchungen, Verhaftungen und Tötungen. Von Demonstrationen, die gewaltsam aufgelöst wurden. Von Menschen, die spurlos verschwanden. Doch all das war nicht zu vergleichen mit der Willkür und Grausamkeit, mit der die Taliban während ihres ersten Regimes in den 90er-Jahren geherrscht hatten. Damals hatten die Islamisten Frauen auf der Straße ausgepeitscht, angebliche Ehebrecherinnen öffentlich gesteinigt, Menschen in voll besetzten Stadien hingerichtet. Genaue Zahlen und Fakten zu den Taten der Taliban lassen sich nur schwer verifizieren. Die großen Massaker, die die Welt befürchtet hatte, sind ausgeblieben. Zumindest bisher.
Veränderungen auf den zweiten Blick
Als ich im November das erste Mal seit der Machtübernahme nach Kabul reiste, sah die Stadt nicht viel anders aus als vor der Taliban-Herrschaft. Wenn ich Bilder von damals und heute vergleiche, sehe ich vor allem einen Unterschied: Die bewaffneten Männer auf den Pick-up-Trucks und an den allgegenwärtigen Checkpoints tragen nicht mehr Uniform, sondern Bärte und Turban. Auch Frauen sind weiterhin auf der Straße unterwegs, die meisten ziehen sich nicht anders an als vor der Machtübernahme. Trotzdem hat die Ruhe etwas Bedrohliches. Die Furcht der Menschen liegt wie ein düsterer Schleier über der Stadt. Er umspielt vor allem die Gesichter der Frauen, die ich im vergangenen Jahr getroffen habe. Da war die Radrennfahrerin Bahara, die ihr Fahrrad zerstörte, weil sie den Anblick nicht ertragen konnte. Das Gerät, mit dem sie früher durch die Berge geheizt ist, stand nun in der Ecke und verstaubte. Abgestellt und lahm gelegt, wie sie selbst. Da war Zahra*, Klassenbeste, die in ihrer Freizeit Gedichte schrieb und es kaum erwarten konnte, Medizin studieren. Doch ihr Vater hatte Schulden bei einem Nachbarn und fürchtete, der Mann könne ihn bei den Taliban denunzieren. Als ein greiser Verwandter anbot, die Schulden zu begleichen, im Austausch für die 15-jährige Tochter als Zweitfrau, willigte der Vater ein. Erst, als Zahra drohte, sich umzubringen, und eine Gruppe von Unterstützerinnen aus Deutschland die Schulden beglich, ließ er sich von dem Vorhaben abbringen. Und da war Nazima, die nicht wusste, wie sie ihre vier Kinder ernähren sollte. Ihr Mann hatte ihr nie erlaubt, zu arbeiten. Als er im März von den Taliban verschleppt, gefoltert und ermordet wurde, war sie auf sich allein gestellt. Ohne Berufserfahrung, ohne Aussicht, ohne Hoffnung.
Die Frauen werden innerlich gebrochen
Es gibt sie noch, die Frauen, die kämpfen. Aber man kann beobachten, wie sie brechen. Ich habe neulich Nazima, eine junge Aktivistin, getroffen, die Afghanistan nicht verlassen, sondern sich den Taliban widersetzen wollte. Nach einer Demonstration im Januar wurde sie festgenommen und zwei Wochen lang von den Taliban verhört und misshandelt. Dann, ohne Vorwarnung, verbanden die Männer ihr eines Nachts die Augen und setzten sie in ein Auto. Während sie schweigend durch die Stadt fuhren, fühlte Nazima Terror, die absolute Gewissheit, an einem unbekannten Zielort hingerichtet zu werden. Doch als das Fahrzeug stoppte, stand sie plötzlich ihrem Vater gegenüber. Ihr Vater musste den Taliban dann versprechen, seine Tochter in Schach zu halten, sonst würde der Familie Schlimmeres drohen. Sie hat sich dann einige Wochen später trotzdem heimlich mit mir getroffen, aber sie wirkte gebrochen. Mit einem Schlag hatten die Taliban sie ihrer Identität beraubt, eine eigene Stimme zu haben und ihre eigenen Gedanken zu äußern – und zwar laut und öffentlich. Wenn sie das jetzt tun würde, würde sie nicht ihr Leben aufs Spiel setzen, sondern das ihrer Familie.
Ein bizarrer Nebeneffekt der Taliban-Herrschaft ist, dass Ausländer:innen sich plötzlich frei bewegen können. Ich kann in Provinzen reisen, in denen Journalist:innen vor einem Jahr noch mit hoher Wahrscheinlichkeit entführt oder ermordet worden wären. Ausgerechnet die Männer, die früher meinen Tod gewollt hätten, sind jetzt für meine Sicherheit zuständig. Im Frühjahr machte ich mich auf den Weg nach Kandahar, der Taliban-Hochburg im Süden des Landes. Als die Taliban am 7. Mai verkündeten, dass Frauen ab sofort zum Tragen der Burka verpflichtet seien, befand ich mich in Sangesar, ausgerechnet dem Ort, an dem sich die Taliban 1994 gegründet haben. Mullah Omar, der Anführer der Taliban-Bewegung, hatte damals in der Moschee des Dorfes gepredigt. An demselben Ort stand ich jetzt im Innenhof und verfolgte die Nachrichten. Auf die Ankündigung der Burkapflicht folgte sofort ein internationaler Aufschrei. Frauenfeindlich sei das Gewand und ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Das sehe ich genauso. Die Burka bedeckt nicht nur die Form, sondern auch das Gesicht der Frau. Sie verwandelt sie zu Geistern, unsichtbar und identitätslos. Die Burka schränkt Frauen in ihrer Bewegungsfreiheit ein, ihrem Sichtfeld und Horizont. Sie ist kein Kleidungsstück. Sie ist ein Gefängnis aus Stoff.
Frauen werden sichtbar unsichtbar
Trotzdem hat mich die Ankündigung irritiert, weil sie mir so unnötig provokativ erschien. Die Burka ist keine Erfindung der Taliban. Sie hat seit Jahrzehnten Tradition in Afghanistan. Frauen haben das Gewand in Zeiten der Monarchie und Demokratie getragen, während des kommunistischen Regimes und der Taliban-Herrschaft. In vielen Teilen des Landes gehen Frauen ohne Burka nicht aus dem Haus – sofern es ihnen überhaupt erlaubt ist, das Haus zu verlassen.
Auf der 15-stündigen Fahrt von Kabul nach Kandahar hatte ich nur eine einzige Frau auf der Straße gesehen: eine bettelnde Witwe unter einer Burka. In Regionen, wo Frauen auf dem Feld arbeiten, ist die vollständige Verschleierung zu unpraktisch. Stattdessen tragen die Arbeiterinnen dort weite Gewänder und lange Schleier, die sie sich schnell über das Gesicht ziehen, wenn ein Mann den Weg passiert. Selbst in den liberalsten Vierteln Kabuls haben sich die Frauen auch vor der Machtübernahme bedeckt gehalten. Von den Hand- bis zu den Fußgelenken war kein Zentimeter Haut zu sehen, die Oberteile gingen mindestens über den Po, besser aber bis zum Knie. Und obwohl es gesetzlich nicht vorgeschrieben war, hat jede Frau ein Kopftuch getragen. Ob eine Frau als züchtig oder schamlos wahrgenommen wurde, war ein Unterschied von Zentimetern: in der Länge des Oberteils, der Weite der Kleidung und ob unter dem Schleier der Haaransatz zu sehen war. Wie oft habe ich geflucht, weil ich mir bei 40 Grad Sommerhitze die Ärmel nicht hochkrempeln durfte, dafür ständig an meinem verschwitzten Kopftuch herumzupfen musste, weil sich darin mal wieder mein Kameraequipment verfangen hatte. Die scheinbare Sinnlosigkeit der Burkapflicht ließ mich nicht los. Warum ein Gesetz erlassen, das in vielen Teilen des Landes seit Generationen ungeschrieben gilt? Warum den wenigen Frauen, die noch ihr Gesicht oder ihre Augen zeigen, das letzte bisschen Freiheit nehmen? Am Abend las ich mir den Gesetzestext durch, der nicht nur die Pflicht beschreibt, sondern auch, wie Verstöße geahndet werden: Wenn sich eine Frau der Burkapflicht widersetzt, wird ihr männlicher Vormund erst verwarnt. Beim zweiten Verstoß kommt er für drei Tage in Haft. Sollte sich die Frau noch immer nicht fügen, entscheidet ein Gericht über sein Schicksal.
Der perfide Plan der Taliban
Auf einmal verstand ich den Sinn des Gesetzes, sah, wie naiv ich gewesen war. Die Taliban sind nicht einfältig. Im Gegenteil. Sie sind perfide. Indem der Erlass nicht Frauen selbst, sondern ihre männlichen Angehörigen bei Verstößen bestraft, macht es alle Männer in Afghanistan zu Komplizen der Taliban. Sie sind für das Verhalten ihrer Frauen verantwortlich, müssen dafür sorgen, dass die weiblichen Angehörigen die Regeln der Taliban befolgen. Der Erlass beraubt Frauen jeglicher Autonomie, gibt ihnen keine Chance mehr, sich gegen die Vorschriften aufzulehnen oder bei Widerstand ins Gefängnis zu gehen. Das Gesetz entmenschlicht Frauen, degradiert sie zu bloßem Eigentum ihrer Brüder, Väter, Ehemänner, Söhne. Zu Vieh, das von seinem Besitzer kontrolliert wird. Es schränkt nicht nur die Freiheit von Frauen ein, es gibt vor allem Männern in der Gesellschaft uneingeschränkte Macht.
Kaum eine Frau in Afghanistan wird sich einer Regel widersetzen, wenn am Ende nicht sie selbst, sondern ihr männlicher Vormund dafür bestraft wird. Wenn es doch eine Frau wagen sollte, wird sie wahrscheinlich keine Märtyrerin für Frauenrechte, sondern nur ein weiteres Opfer von häuslicher Gewalt. Afghanistan galt auch vor der Herrschaft der Taliban als eines der schlimmsten Länder für Frauen weltweit. Ich kannte Frauen, die von männlichen Angehörigen geschlagen, verstümmelt, mit Säure überschüttet und in Brand gesetzt wurden. Oft erzählten mir Mädchen, dass sie auf einen guten Ehemann hofften. Also einen Mann, der sie nicht grundlos schlage. Die Grausamkeit nahm teils absurde Züge an: So waren früher mit die sichersten Orte für Frauen die Gefängnisse – wo viele wegen Mordes einsaßen, nachdem sie ihre Peiniger umgebracht hatten. Stück für Stück sorgen die Taliban dafür, dass sich Frauen in die totale Abhängigkeit von Männern begeben müssen. Um diesen Prozess zu stoppen, müssten die Männer für ihre Frauen demonstrieren gehen. Die Vorstellung ist so absurd, so weit weg von der Realität der afghanischen Gesellschaft, dass weiterführende Schulen für Mädchen nach der Machtübernahme nie wieder aufgemacht haben. Frauen mussten ihre Jobs aufgeben. Die Universitätsprogramme laufen langsam aus. Wie das Puzzle am Ende aussehen soll, das die Taliban schleichend zusammensetzen, kann ich nicht sagen. Aber ich habe eine Ahnung. Ich dachte, eine Reise zum Ursprung hilft vielleicht, die Geschehnisse zu verstehen. Also fuhr ich los.
Der Alltag der afghanischen Frauen
In Sangesar, dem Entstehungsort der Taliban, weigerten sich die Männer, mit mir zu reden. Also lief ich los, um mich im Dorf umzusehen. Es bestand aus nicht viel mehr als einem Dutzend Lehmhütten, jede umringt von hohen Mauern. Neben staubigen Straßen lagen Opiumfelder, die Blüten bereits verdorrt. Kein Strom, kein fließendes Wasser, keinen Handyempfang gab es hier. Der Ort wirkte surreal auf mich, wie eine entsättigte Fotografie aus einer anderen Zeit. Am Eingang eines Hauses entdeckte ich eine Gruppe kichernder Mädchen. Als ich sie anlächelte, rannten sie weg, versteckten sich hinter der Mauer, schauten dann wieder neugierig zu mir. Nach ein paar Minuten fasste eines den Mut und winkte mich zu sich. Ich folgte ihm in den Innenhof, wo zwischen Ziegen und Feuerholz auf einmal erwachsene Frauen standen. Zum ersten Mal seit Tagen sah ich keine blauen Geister, sondern wunderschöne Menschen in bunt bestickten Kleidern und mit Kajal geschminkten Augen. Der Ort, der mir gerade noch unwirklich vorgekommen war, füllte sich plötzlich mit Leben. Und mit Fragen. Die Frauen redeten auf mich ein, bevor ich den ersten Satz sagen konnte. Ich versuchte, ihnen zu erklären, dass ich kein Pashto verstehe. Erfolglos. Am nächsten Tag kehrte ich mit einer Übersetzerin zurück. Nach einigem Zögern erlaubte mir der Herr des Hauses, mit seinen weiblichen Angehörigen zu sprechen. Allerdings von Burkas verhüllt, auf dem Boden des Viehstalls, unter männlicher Aufsicht. Als Journalistin stelle ich normalerweise die Fragen. Hier hatte ich keine Chance. Die Frauen redeten alle gleichzeitig. Wieso bist du hier? Wo kommst du her? Was willst du von uns? Hast du keine Eltern oder Brüder? „Doch“, sagte ich, „ich habe Eltern, ich habe Brüder und einen Verlobten.“ „Und die lassen dich so rumlaufen?“ Ich erklärte ihnen, dass ich aus einem Land komme, in dem Frauen ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Dass ich jederzeit überall hingehen dürfe, in die Schule, zur Arbeit, ohne die Erlaubnis eines Mannes. Dass ich selbst entscheiden könne, wann und wen und ob ich überhaupt heiraten wolle. Es wurde still im Raum. „Wir müssen unsere Männer für alles um Erlaubnis fragen“, sagte die älteste Frau schließlich und wurde sofort von dem Aufpasser, ihrem minderjährigen Sohn, zurechtgewiesen, nicht so viel zu reden. Ich wollte wissen, womit sie ihre Zeit verbringen, ob es etwas gebe, dass sie nur für sich täten. Etwas, das nichts mit Haushalt oder Kindern zu tun hätte. „Ich lese zum Beispiel Bücher, höre Musik, treffe mich mit Freundinnen oder schaue Filme.“ „Wir tun nichts davon“, sagte die erste Frau. „Wir gehen noch nicht mal zum Arzt“, sagte die zweite. Jemals zur Schule? „Nein.“ Ob sie das gerne wollten? Der Junge ließ seiner Mutter und seinen Cousinen keine Chance, zu antworten. Es reiche nun mit den Fragen, und sie sollten nicht auf die Idee kommen, ihre Burka auszuziehen. Ich wollte die Frauen nicht in Schwierigkeiten bringen und verabschiedete mich. Beim Rausgehen stellte ich eine letzte Frage: „Seid ihr jemals in eurem Leben gereist, woanders gewesen als hier?“ „Was meint sie“, fragte eine der jüngeren Frauen die älteste, „ob wir schon mal bei unseren Nachbarinnen waren?“
Vor dem Haus warteten die Männer des Dorfes. Einer fragte mich, ob ich ihn heiraten wolle, dann wäre mein Leben besser. Ich entgegnete, dass ich sein Angebot leider ablehnen müsse, da ich zu gerne aus dem Haus ginge. Er lachte. „Unsere Frauen wollen nicht aus dem Haus gehen, weil wir es ihnen verbieten.“ Auf dem Rückweg nach Kandahar war mir schlecht. 70 Prozent der afghanischen Bevölkerung lebt außerhalb von Städten. In vielen Regionen dürfen Frauen nur bis zur Pubertät das Haus verlassen. Dann erst wieder als Großmütter. Zu Besitz degradierte Leben, in einer auf wenige Quadratmeter beschränkten Welt. Seit Jahren geht mir ein Satz nicht aus dem Kopf, den eine junge Bergsteigerin 2017 zu mir in Kabul gesagt hat: „In den Bergen habe ich das erste Mal in meinem Leben realisiert, dass ich meine eigenen Gedanken habe.“
Die Zukunft der afghanischen Frauen
Die afghanische Gesellschaft war schon immer konservativ. Ich glaube, den meisten Menschen ist nicht bewusst, wie viel Mut und Stärke Frauen in den letzten 20 Jahren bewiesen haben, wenn sie ihre Stimme erhoben oder eigene Entscheidungen getroffen haben. Frauen haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um Kunst zu studieren, auf Berge zu klettern, Männern zu widersprechen. Viele sind für genau solche Dinge – Äußerungen und Handlungen, die in unserer Gesellschaft noch nicht einmal als Privileg wahrgenommen werden, sondern selbstverständlich sind – grausam ermordet worden. Das waren Kämpferinnen, bereit, für ihre Rechte zu sterben. Wir sprechen immer von unseren Verbündeten in Afghanistan. Für mich sind es die Frauen, die für Rechte wie Bildung gekämpft haben, mit denen auch Deutschland seinen Einsatz in Afghanistan immer wieder begründet hat. Diese Frauen waren Kämpferinnen, angetrieben von ihrem Glauben, in ihrer Ideologie kompromisslos und bereit, für die Sache zu sterben. So wie die Taliban – nur auf der guten Seite der Macht. Einige haben es nach Deutschland geschafft. Shogufa zum Beispiel, die Bergsteigerin. Ich sehe, wie viele der Frauen aufblühen, die jetzt in Deutschland sind. Die klettern gehen, Deutsch lernen, sich für Umweltschutz einsetzen. Die endlich die Freiheit leben können, für die sie so lange gekämpft haben.
Im Dezember 2021 hatte Außenministerin Annalena Baerbock zu Afghanistan gesagt: „Viele Menschen leben in täglicher Angst. Das gilt besonders für diejenigen, die mit uns für eine bessere Zukunft Afghanistans gearbeitet, daran geglaubt und sie gelebt haben. Am schwersten ist die Lage für die besonders gefährdeten Mädchen und Frauen. Gegenüber diesen Menschen haben wir eine Verantwortung, und wir werden sie nicht im Stich lassen.“ Acht Monate später gibt es noch immer kein Aufnahmeprogramm für Frauen und Mädchen.
Im Juni habe ich eine junge Englischlehrerin in Kabul getroffen, die Mädchen in einer Privatschule unterrichtet. Sie erzählte mir, wie sehr sie ihren Job liebe. Und dass heute wahrscheinlich ihr letzter Tag sei. Als ich nach dem Grund fragte, seufzte sie. „Meine Eltern haben mich gestern verlobt. Und du weißt ja, wie das ist in Afghanistan.“ Mit jeder Woche, die vergeht, wird es für Frauen schwieriger, Afghanistan zu verlassen. Am meisten beschäftigen mich die Afghaninnen, die in 20 Jahren Krieg aufgewachsen sind und trotzdem an eine bessere Zukunft für sich geglaubt haben. Mädchen, die gerade die Schule abgeschlossen haben, können nicht mehr studieren. Studentinnen, die ihr Examen bestanden haben, bekommen keinen Job mehr. Die Armut wird größer, die Töchter nutzloser. Ich kenne viele Afghaninnen, die sich dem elterlichen Druck, zu heiraten, nur widersetzen konnten, weil sie noch studiert oder zum Einkommen der Familie beigetragen haben. Manchmal stelle ich mir vor, wie eine Reihe junger Frauen an einem Abgrund steht. Jeden Tag stürzt eine von ihnen hinein. Ich finde den Gedanken unerträglich, dass wir ihnen das Leben hätten ermöglichen können, nach dem sie sich gesehnt haben. Wenn wir früher gehandelt hätten. Wenn wir erkannt hätten, dass die Taliban Frauen nicht mit Kugeln töten, sondern langsam ihre Seelen sterben lassen.
*Die Namen der Frauen sind zu ihrem Schutz teilweise geändert.