Netzwerk
Mitglieder
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.


In der Vergangenheit hat die Welt meine Heimat Borneo in seiner Exotik gesehen und nannte sie die „Lunge der Erde“ – darin klingen all die Hoffnungen auf die Schönheit und Gnade Gottes mit. Doch dieses Borneo ist nicht mehr da, verändert, jetzt sprechen alle nun noch über das unglückliche Schicksal der Insel, die zerstört und ausgeplündert wird. Ich bin hier geboren und fühle mich verpflichtet, die Umwelt meiner Heimat zu erhalten und zu schützen. Daher engagiere ich mich beim Borneo Institut in der indonesischen Stadt Palangkaraya. Hier haben wir ein Forum eingerichtet, wo alle Ebenen der Gesellschaft in einen Dialog miteinander treten können. Wir versuchen, die Sensibilität der Menschen zu schärfen für (wirtschaftliche) Richtlinien, die Umweltschäden mitverursachen.
Die Hauptursache für die Umweltzerstörung auf Borneo sind der Ausbau von Ölpalmenplantagen und der Bergbau, die sich auch auf den Klimawandel auswirken. Wälder, in denen Flora und Fauna beheimatet sind, werden gerodet und durch Plantagen oder Minen ersetzt. Diese Situation ist kritisch und besorgniserregend. Fast alle Gebiete in Zentral-Borneo sind mittlerweile von Überschwemmungen, Erdrutschen und Flächenbränden bedroht. Diese gefährlichen Folgen der Umweltzerstörung sind weder ein Fluch Gottes noch eine Glaubensprüfung. Sie sind die Schuld von Menschen, die sich nicht um die Natur scheren. Dies ist eine logische Folge der Gier einer Handvoll Menschen, die Macht über andere Menschen ausüben und ihre eigenen Interessen über die der Gemeinschaft stellen.
Diese Situation verschärft sich, wenn der Staat sich nicht auf die Seite des Volkes. Statt ökologische Nachhaltigkeit zu verteidigen, schlagen und verfolgen Militär und Polizei Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen. Selbst gewöhnliche Umweltaktivisten werden kriminalisiert und beschuldigt, Fortschritt und Entwicklung zu behindern. 2018 war ich selbst mit Provokationen von staatlichen Institutionen konfrontiert, die Gewohnheitsrechte der Einwohner kriminalisieren wollten. Solche Erfahrungen verleiten manchmal, gleichgültig zu werden. Doch meine Liebe und mein Respekt für dieses Land haben mich für einen harten Kampf geschmiedet.
Wir hoffen, dass Länder in Europa und insbesondere Deutschland – als Land, das sich um ökologische Nachhaltigkeit und Menschenrechte bemüht – weiterhin ein Klima der Demokratie schaffen. Ein Klima, das eine ökologische Perspektive vermittelt und die Umwelt und die gesamte Schöpfung schützt. Darüberhinaus hoffen wir auch auf eine Anerkennung und Unterstützung für die indigenen Völker, weil diese ausgezeichnete Umweltschützer sind: Sie sehen die Wälder als ihre „Mütter“ und den Schutz der Natur setzen sie gleich mit dem Schutz der Gebärmutter der Menschheit. Wir müssen von unseren Vorfahren lernen, wie wichtig der Schutz der Umwelt für die Erde ist, auf der wir leben. Ich hoffe, dass sie zum Vorbild für die jüngere Generation werden können, um die Umwelt weiter zu bewahren und ökologische Gerechtigkeit zu vermitteln.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Hamburg, 15. Juli 2020: Bettina Rühl, die Vorsitzende von weltreporter.net, wird für ihre Arbeit als unabhängige Afrika-Korrespondentin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Vorgeschlagen hat sie dafür der Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas, aufgrund ihrer „überdurchschnittlich engagierten und bemerkenswerten Recherche-Arbeit in und ihre Berichterstattung über Afrika“.

Bettina Rühl auf Recherche
Die Ordensinsignien werden ihr am 30. Juli 2020 in Nairobi, Kenia in der deutschen Botschaft durch die dortige Botschafterin Annett Günther überreicht. Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier hat Bettina Rühl das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland bereits im Mai verliehen. International ist es mit dem Ritterkreuz gleichzusetzen. Bettina Rühl reiht sich damit unter bisherige Träger wie die Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen, die Schauspielerin Katja Riemann und den Weltreporter-Kollegen Arndt Peltner.
Wir gratulieren unserer Vorsitzenden von ganzem Herzen und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg, Biß und Durchhaltevermögen für ihre Arbeit.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
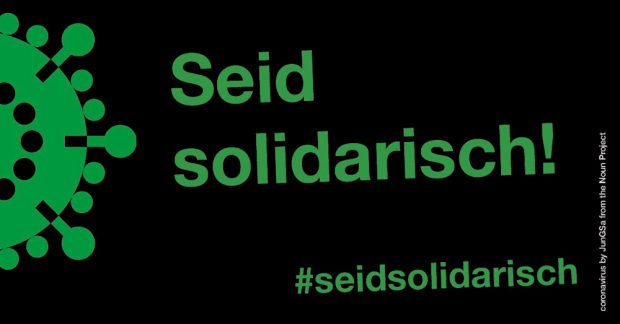
weltreporter.net schließt sich dem Aufruf der Freischreiber, dem Berufsverband freier Journalisten und Journalistinnen, an:
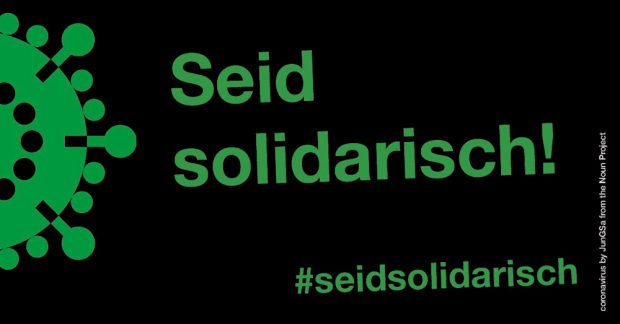
Ausfallhonorare zahlen, Ersatzaufträge anbieten, Absicherung freier Journalist*innen verbessern: weltreporter.net appelliert an die Solidarität der Redaktionen mit ihren freien Journalist*innen.
Wir freien Journalist*innen sind eine tragende Säule der deutschen Medienlandschaft. Wir versorgen die Öffentlichkeit mit gut recherchierten Informationen. Wir berichten aus aller Welt. Sprechen mit Expert*innen und tragen die Fakten zusammen, verifizieren, überarbeiten – oft rund um die Uhr. Weil wir unseren Job lieben, weil wir um unsere Verantwortung wissen, weil wir unseren Teil dazu beitragen wollen, auch diese Krise gemeinsam zu meistern.
Gleichzeitig ist die Krise für viele freie Journalist*innen eine existenzielle Bedrohung: Veranstaltungen und Interviews werden abgesagt, vereinbarte Beiträge zu anderen Themen durch die Berichterstattung über die Pandemie verdrängt. Die Folge: massive Umsatz- und Einkommensausfälle, und das in einer Situation, in der freie Journalist*innen vielfach bei voller Arbeit nur weniger als halb so viel wie festangestellte Redakteur*innen verdienen. Die Bildung von Rücklagen ist so nur kaum möglich, siehe Freischreiber-Honorar-Report.
Aus diesem Grund appellieren wir an die Auftraggeber*innen: Helft euren freien Kolleg*innen mit schnellen und unkomplizierten Zahlungen, rechnet Beiträge, die nun verschoben werden, schon jetzt ab. Und zahlt freien Journalist*innen, die einen Termin nicht wahrnehmen können, weil Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden, unkomplizierte Ausfallhonorare.
Helft ihnen auch, wenn eine Veranstaltung zwar stattfindet, der oder die Kolleg*in sie aber nicht wahrnehmen kann, weil Schulen oder Kindergärten geschlossen haben und die Kinder betreut werden müssen. Habt ein offenes Ohr für eure Freien. Seid solidarisch!
Ihr Redaktionen und Verlage da draußen – jetzt ist der Moment, über den Code of Fairness hinauszuwachsen. Gebt euren freien Kolleg*innen Ersatzaufträge. Lasst uns die Zeit gemeinsam dafür nutzen, neue Formate zu entwickeln. Eure Freien sind oft Top-Expert*innen in ihren Themen. Nutzt das! Für Webinare, für Video-Konferenzen, für Projekte, die schon lange in euren Schubladen liegen. Schiebt sie jetzt an. Ein Gutes hat die Krise: Der Wert von gutem Journalismus wird jetzt endlich wieder wahrgenommen. Nutzen wir das zum Positiven. Halten wir zusammen. Euer Geld, unsere Expertise. Waschen wir uns die Hände und packen es gemeinsam an.
Aufruf als PDF.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Diskussion am 26. Oktober 2019 um 19 Uhr im Grünen Salon der Volksbühne Berlin.
Was im Ausland passiert, hat unmittelbare Folgen für uns und unser Leben in Deutschland. Korrespondenten schlagen die Brücke zwischen dem, was in der Ferne wichtig ist, und dem, was heimische Leser, Zuhörer und Zuschauer interessiert. Doch dieses Modell ist gehörig ins Wanken gekommen – die Folge: ein zunehmend verzerrtes Bild von der Welt.
Medienhäuser dünnen ihre Korrespondentennetze seit Jahren aus, unter ihnen auch die wichtigen Nachrichtenagenturen. Immer häufiger werden Auslandsberichte in deutschen Redaktionen geschrieben. Im Krisenfall fliegen Redakteure an Hotspots, wo sie wenig mehr tun können, als sich ihre Vorurteile bestätigen zu lassen, wenn sie überhaupt ins Land kommen. Autoritäre Staaten wie die Türkei verweigern Berichterstattern die nötige Zulassung oder – wie in China – Reisegenehmigungen innerhalb des Landes. Wo Berichterstattung schwierig oder teuer ist, bestimmen interessengeleitete Organisationen oder Individuen, was wir wissen. Selbst Tweets ungeklärter Herkunft gelten gegen alle journalistischen Grundsätze zu oft als Quelle.
Dieser Trend ist auch deshalb beunruhigend, weil Bundesregierung und Bundeswehr als Akteure in internationalen Krisen gefragt sind. So sitzt Deutschland seit diesem Jahr im Weltsicherheitsrat, ist Teil von Blauhelmmissionen. Bürgerinnen und Bürger müssen den Sinn von Interventionen beurteilen können. Dafür braucht es qualitativ hochwertige, journalistisch saubere und langfristig angelegte Berichte von Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. Ihre Arbeit ist unerlässlich.
Das gilt besonders, weil die Glaubwürdigkeit von Medien – nicht nur in Deutschland – immer massiver zum Politikum gemacht wird. Das Label „fake news“ ist zu einer beliebten rhetorischen Figur geworden, mit der die Argumente des politischen Gegners vom Tisch gewischt werden. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten gründlich recherchieren und „sauber“ berichten, egal aus welchem Winkel der Erde. Dafür braucht es Ressourcen.
Weil die aber häufig fehlen oder anderswo eingesetzt werden, bekommt die deutsche Bevölkerung ein zunehmend verzerrtes Bild der Welt präsentiert.
Was kann und muss also unternommen werden, um fundierte und unabhängige Auslandsberichterstattung in Deutschland zu garantieren? Welche Verantwortung tragen Redaktionen, Korrespondenten, Herausgeber? Was muss die Bundespolitik tun, um für die Freiheit der Auslandsberichterstattung zu streiten? Welche neuen Modelle brauchen wir, um gründliche und unabhängige Berichterstattung künftig finanzieren zu können?
Diese und andere Fragen diskutieren Redakteure, Wissenschaftler, Korrespondenten und das Publikum bei unserer Veranstaltung anlässlich des 15. Geburtstages der “Weltreporter”, des größten Netzwerkes freier Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten aus dem deutschsprachigen Raum.
Teilnehmer: Bettina Rühl (Weltreporter), Jochen Wegner (Chefredakteur Zeit online), Marcus Bensmann (correctiv), Lutz Mükke (Reporter und Medienwissenschaftler). Moderation: Anke Bruns.
Unterstützt wird die Veranstaltung von torial.com, der Online-Plattform für JournalistInnen, und der Deutschen Post DHL Group.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Kennen Sie das: Wenn die Fremde vertraut wird, und die Heimat eher befremdlich? Wir Weltreporter erleben dieses seltsame Spannungsverhältnis häufig, privat ebenso wie während Recherchen für Reportagen. Identität – was macht uns aus, was ist wo vertraut? Wie funktioniert dieses Phänomen “Heimat”, wenn man sich an vielen Orten zuhause fühlt – oder nirgends so richtig? Im Weltreporter-Podcast #2 ist das Podcast-Team für Sie diesen Fragen nachgegangen.
Die Idee entstand durch eine Geschichte, die Afrika-Weltreporterin Bettina Rühl aus Somalia mitbrachte. Bettina hatte in Mogadischu Menschen getroffen, die trotz Krieg in die somalische Hauptstadt zurückgekehrt sind: Von sicheren Orten, an die sie geflüchtet waren, zurück an einen sehr riskanten.

Abdullahi Muse Hassan in seiner Druckerei in Mogadischu.
Warum geht man in die Heimat zurück, auch wenn es gefährlich ist? Warum gehen andere nicht zurück – wie viele Weltreporter?
In Skype-Gesprächen über das Thema Identität zwischen London, Kairo, Durban, Südfrankreich und Kalifornien kamen die WR-Podcaster auch schnell darauf, warum sie genau dort sind, wo sie sind – und was sie manchmal dort vermissen. Und sie haben andere Reporter gefragt, was ihnen – außer Vollkornbrot – fehlt: einen richtig schönen deutschen Streit, Gemütlichkeit, Biergärten, deutsche Buchläden, Schnee und Radwege spielten in den Statements aus aller Welt ihre Rollen.
Birgit Kaspar, Weltreporterin in Frankreich, hat schon an vielen Orten gelebt. Für sie ist “Identiät” auch ein Spannungsfeld zwischen Polen. “Identität” schmeckt für sie manchmal orientalisch oder klingt Kölsch, zuweilen ist sie auf ewig “l’Allemande” und zugleich französische Nachbarin. Außerdem hat Birgit Kaspar mit Youssouf gesprochen – er gehört zu denen, die nicht zurück wollen.

Kirstin Ubesleja und ihre drei Pässe
Youssouf ist einer von einem Dutzend Somaliern, die in Saint Martory auf ihre Papiere warten und Französisch lernen, damit sie sich im Gastland integrieren können. Was er trotz einiger Hürden an der Fremde liebt, hören Sie im Podcast.
Wer Gespräche über die doppelte Staatsbürgerschaft knifflig findet, sollte Kerstin Zilm zuhören. Die Reporterin hat in Los Angeles Kirstine Upesleja interviewt, eine Frau, die staatenlos geboren ist und heute gleich drei Pässe hat. Kirstine Upeslejas Eltern stammen aus Lettland, sie ist in Münster aufs lettische Gymnasium gegangen und hat eine “emotionale Beziehung” zu dem Land, das sie oft besucht, in dem sie aber nie gelebt hat. Sie lebt in Amerika, spricht aber (ihrer Ansicht nach) nur deutsch perfekt. Im Podcast erzählt sie, wie die mit einem derartigen Identitätenmix klarkommt.

Jürgen Stryjak isst echt deutsch: Original German Döner Kebab.
Seit über 25 Jahren ist Jürgen Stryjak Korrespondent in Kairo, und für den Podcast hat er sich mit dem wichtigsten aller Themen der Heimatferne beschäftigt: Mit dem Essen. Er verrät, was Ägypter meinen, wenn sie so richtig ägyptisch (zum Beispiel KFC) essen gehen wollen. Und er lädt ein zum ersten “echt deutschen Döner Kebab” in Kairo. “Überfremdung” im Doppeltwist, oder upside down würde ich sagen – aber hier unten auf meiner Globushälfte fließt das Wasser ja eh andersrum ab, heißt es.
Viel Spaß mit dem zweiten Podcast der Weltreporter, diesmal zusammengestellt von Kerstin Zilm, Jürgen Stryjak, Birgit Kaspar, Leonie March und Sascha Zastiral.
PS: Sie haben den ersten WR-Podcast verpasst? Hören Sie ihn in der Soundcloud an. Alle drei Monate erzählen weltreporter von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark und laden ein zum Blick hinter die Kulissen, mitten in den Korrespondentenalltag.
Im Podcast #1 treffen Sie einen Weltreporter-Gründer, hören, welches Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält, welche Eigenschaften zum Job gehören und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.


Farbenspiele im winterlichen Helsinki (Foto: Bomsdorf)
Frauke Petry verlässt die AfD und gründet angeblich eine neue Partei mit “blau” im Namen. Schon ihr Vorwurf an die neuen Chefs (wenn man Gauland, Weidel so bezeichnen mag), dass sie ihr zu rechts geworden seien, erinnert sehr an Finnland. Nun also angeblich auch der Name “Die Blauen”.
In Finnland wählten die Wahren Finnen (auch Basisfinnen genannt) mit Jussi Halla-aho im Juni 2017 einen neuen Parteivorsitzenden, der seinem Vorgänger, Außenminister Timo Soini, zu rechts wahr und zwar so viel, dass er die Partei verließ und damit die Regierung rettete. Soini hat dann die Blaue Zukunft gegründet. Die Abspaltung ist in gewisser Weise mit der von Petry zu vergleichen, einmal war es der frühere Vorsitzende, der in der Regierung war, einmal die amtierende Vorsitzende, die samt ihrer Partei erstmals in das nationale Parlament kam.
Der Blauen Zukunft werden weniger als 2% der Wählerstimmen vorausgesagt während sich die Wahren Finnen noch bei mehr als 10% halten. Womöglich wird Petrys Neugründung auch dieses Schicksal blühen. Einen Artikel von mir zu Dänischen Alternativen für Deutschland gibt es hier.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.


Khadija Ismayilova (Foto: Right Livelihood Award)
Journalistenpreise gibt es viele, Nobelpreise wenige. Und dann gibt es da noch den Alternativen Nobelpreis des Schweden Jakob von Uexküll, offiziell heißt die Ehrung Right Livelihood Award. In diesem Jahr wird damit unter anderem eine Journalistin ausgezeichnet: Adija Ismayilova aus Aserbaidschan. Das hat auch mit Deutschland zu tun.
Ismayilova erhält die Auszeichnung „für ihren Mut und ihre Hartnäckigkeit, Korruption auf höchster Regierungsebene durch herausragenden investigativen Journalismus aufzudecken“, wie es seitens des Right Livelihood Awards heißt. “Ich nehme die Auszeichnung im Namen aller Journalisten und Verteidiger der Menschenrechte in meinem Land an, die trotz schwierigster Bedingungen unermüdlich weiterarbeiten”, lässt sich Ismayilova zitieren. Als Weltreporter wissen wir, es braucht mehr dieser Journalisten. Überall.
Laut Right Livelihood Award ist “Khadija Ismayilova ist die bedeutendste investigative Journalistin Aserbaidschans. In den vergangenen zehn Jahren hat ihre Berichterstattung den Umfang der korrupten und lukrativen Geschäfte der herrschenden Elite Aserbaidschans dokumentiert, in die auch Familienmitglieder von Präsident Aliyev involviert sind.
Sie hat Beweise für Korruption auf höchster Regierungsebene gefunden, die auch multinationale Unternehmen wie TeliaSonera betrafen. Ihre Recherchen und Dokumentationen zeigen auf, wie der Reichtum der Nation geplündert und ins Ausland geschleust wird. Mit dem Geld werden zum Beispiel europäische Politiker beeinflusst, wie der aktuelle Fall der CDU-Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der Deutsch-Südkaukasischen Parlamentariergruppe Karin Strenz zeigt: Die Politikerin äußerte sich gegen hohe Zahlungen aserbaidschanischer Lobbyfirmen positiv über das Regime, lobte im Gegensatz zur OSZE-Beobachtermission die Wahlen 2010 und stimmte als einzige deutsche Abgeordnete im Europarat gegen eine Resolution zur Freilassung politischer Häftlinge in Aserbaidschan. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte Ismayilova: “Solche Leute ermöglichen es dem Regime, unsere Freiheit zu unterdrücken und uns ins Gefängnis zu bringen.“
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der 3. Mai ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Um die allerdings ist es nicht sonderlich gut bestellt. Der Verband Reporter ohne Grenzen (ROG) hat zu diesem Termin eine überraschende und teils erschreckende Rangliste mit vielen Hintergründen zur Pressefreiheit in der Welt zusammengestellt.
 Es ist ein hochspannendes und informatives Dokument, viel mehr als eine Liste.
Es ist ein hochspannendes und informatives Dokument, viel mehr als eine Liste.
Ein Blick auf die interaktive Weltkarte der ROG-Kollegen ist extrem aufschlussreich. Denn in der Übersicht geht es nicht nur darum, wo Journalisten, die ihre Arbeit erledigen wollen, dabei behindert oder sogar festgenommen werden.
Es werden auch Manipulationen und Monopole angesprochen – und keineswegs nur Einschränkungen in Diktaturen.
„Besonders erschreckend ist, dass auch Demokratien immer stärker unabhängige Medien und Journalisten einschränken, anstatt die Pressefreiheit als Grundwert hochzuhalten“, sagt ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske zu dem Ranking, für das vor allem Ereignisse und Daten aus 2016 zusammengetragen wurden.
Zur Verschlechterung der Lage für Journalisten tragen weltweit auch medienfeindliche Rhetorik, beschränkende Gesetze und politische Einflussnahme bei. Deutschland hält sich auf der Liste unverändert auf Platz 16. Australien steckt zwischen Surinam und Portugal auf Platz 19. Nicht zuletzt weil in meinem Berichtsgebiet Journalisten beispielsweise nicht unbehindert über die Flüchtlingspolitik berichten dürfen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Vorvergangenen Freitag, 7. April 2017, wurde ein Anschlag in der Stockholmer Innenstadt verübt. Ähnlich wie in Berlin raste ein LKW durch die Fußgängerzone und der Fahrer ermordete so vier Menschen. Vier Menschen, die ihren Angehörigen entrissen wurden und deren Leben durch Terror gewaltsam beendet wurde. Eine schreckliche Tat, die dazu geführt hat, dass viele Schweden öffentlich ihr Mitgefühl ausgedrückt sowie der Polizei gedankt haben.
Über die Hintergründe des mutmaßlichen islamistischen Terroristen habe ich unter anderem für Zeit online (hier über die schwedischen Reaktionen und hier unmittelbar nach der Tat) berichtet und auch einen Kommentar für die Deutsche Welle geschrieben. Auf Artikel und Kommentar wurde wiederum mit einigen Leserkommentaren geantwortet. Die Debatten, die das Internet ermöglicht, sind eine hervorragende Möglichkeit, das Meinungsmonopol (wenn man es denn so nennen möchte) der Journalisten zu brechen.
Ziemlich häufig jedoch, geht es längst nicht um Debatten, sondern was in den Kommentarspalten zu lesen sind, sind Pauschalverurteilungen und Wutausbrüche. Als Antwort auf einige Kommentare unter meinem Kommentar für die Deutsche Welle habe ich selber eine Antwort verfasst. Denn Debatten sind es, die nötig sind, und nicht Pauschalvorwürfe. Hier also meine Antwort (die bei DW nicht mehr veröffentlicht werden konnte, da die Kommentarfunktion nur kurzzeitig offen ist):
“Vielen Dank für die zum großen Teil kritischen Kommentare, auf die ich gerne kurz antworten möchte. Die Angehörigen der Opfer dieser grausamen Tat verdienen unser aller Mitgefühl und denen, die in Stockholm getötet worden sind, gilt es zu gedenken. Das ist bei einer solchen Tat eine Selbstverständlichkeit und anders als manch Kommentator schreibt, meine ich nicht, dass „die Opfer und ihre Familien schnell vergessen werden müssen“. Derartiges steht in meinem Kommentar nicht. Das wird jedem, der diesen wirklich gelesen hat, klar sein.
Was ich in meinem Kommentar hingegen tue, ist auf die gesellschaftlichen Folgen einer derartigen Terrortat zu fokussieren. Das heißt ganz und gar nicht, die schrecklichen Folgen für die Familien in Abrede zu stellen. Dass manch ein Leser es so gelesen hat, gibt mir zu denken, manchmal kommt man nich umhin zu erwägen, ob es Leser gibt, die aus einem Text nur das herauslesen, dass sie lesen möchten. Für eine Familie ist es grausam, einen Angehörigen durch eine derartige Terrortat zu verlieren, diesen gilt unser Mitgefühl.
Im Text erwähne ich auch andere Taten und Unfälle, die in Teilen dem aktuellen Attentat ähneln. Immer wieder wird einem bei Vergleichen der Vorwurf gemacht, gleichzusetzen. Doch vergleichen und gleichsetzen sind verschiedene Dinge. Von daher wird in diesem Text Terror nicht mit einem Unfall gleichgesetzt. Verglichen werden kann, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Das mag manchmal schwieriger sein als einfach gleichzusetzen, doch es sind die differenzierten Betrachtungen, die Diskussionen ermöglichen, die Politik und Gesellschaft weiterbringen können. Wer die Terrorgefahr überhöht und andere Risiken verdrängt (so sind alleine im Januar auf Deutschlands Straßen 234 Menschen ums Leben gekommen – Tendenz glücklicherweise fallend), hat einen großen Wunsch der Terroristen womöglich schon erfüllt: panisch und irrational zu reagieren.
Zuletzt noch kurz zum Zitat des israelischen Historikers Yuval Noah Harari. Es handelt sich selbstverständlich um eine Art bildhaften Vergleich. Ihm geht es explizit darum, was derartiger Terror (die Fliege) mit Europa (der Porzellanladen) macht. Auch Harari spricht also von gesellschaftlichen Auswirkungen und nur weil er die schrecklichen Folgen für die einzelnen Familien nicht erwähnt, negiert er diese noch lange nicht. Es geht auch ihm um eine Betrachtung der möglichen gesellschaftlichen Bedrohung. Das gesamte Interview mit ihm ist im Spiegel 12/2017 erschienen und auch online zu lesen (derzeit jedoch nur gegen Bezahlung). Dass Terrorismus (die Fliege) bekämpft werden sollte, dafür würde sich sicherlich auch Harari aussprechen.
Dass Terror durch geschlossene Grenzen nicht verhindert wird, zeigen Beispiele der letzten Jahrzehnte wie NSU und RAF. Und: Nein, andere (rechts- wie linksxtremistische) Terrortaten zu erwähnen, ist weder Gleichsetzung noch Verharmlosung islamistischen Terrors, sondern lediglich ein differenzierter Beitrag zur Debatte.”
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

 Geschlechterkampf Munch-Raum im Frankfurter Stäfel (Foto: Bomsdorf)
Geschlechterkampf Munch-Raum im Frankfurter Stäfel (Foto: Bomsdorf)
In der aktuellen Ausstellung Geschlechterkampf im Frankfurter Städel Museum ist gleich ein ganzer Raum fast nur mit Bildern des Norwegers Edvard Munch gefüllt. Die Schau habe ich zuerst zur Eröffnung im November gesehen, damals mir den Katalog aber nicht genau genug angeschaut. Jedenfalls war mir nicht aufgefallen, dass dadrin auch Donald Trump gedankt wurde! Der war damals noch nicht US Präsident. Das war auch gar nicht entscheidend für den Dank, denn, so das Kuratoren-Duo aus Felicity Korn und Felix Krämer: „Bei der Vorbereitung unserer Ausstellung mussten wir häufig erklären, weshalb eine Ausstellung zum Geschlechterkampf in der Kunst zwischen 1860 und 1945 wichtig ist und dass es sich bei der Problematik weiterhin um eine gesellschaftliche Realität handelt. Durch seine Äußerungen im US-Wahlkampf hat Donald Trump – unfreiwillig – zahlreiche dieser Skeptiker überzeugt, dass der Geschlechterkampf ein hochaktuelles Thema ist.“
Deshalb also gebührte ihm zugegebenermaßen etwas ironisch Dank. Ähnlich überraschend wurde übrigens Justizminister Heiko Maas gedankt und noch ein paar weiteren. Wer sich nicht nur für Kunst interessiert, sondern auch für aktuelle gesellschaftliche und politische Diskussionen, wird sich denken können, warum. Und natürlich danken die beiden einigen auch ernsthafter. Dazu habe ich nach meinem zweiten Besuch der Ausstellung Ende Januar eine ganz kleine Geschichte für The Art Newspaper geschrieben, zu lesen hier. Zur Ausstellung geht es hier.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Dass Aarhus zur europäischen Kulturhauptstadt 2017 in Dänemark ernannt wurde, hat in Norddeutschland viele enttäuscht. Schließlich hatte sich Konkurrent Sonderburg mit Flensburg beworben und hätte so – obwohl noch gar nicht wieder an der Reihe – auch Deutschland zu ein wenig europäische Kulturhauptstadt verholfen.

Theater in der Kulturhauptstadt Aarhus (Foto: Bomsdorf)
Nun also Aarhus und auch das hat für Norddeutschland seinen Reiz. Schließlich ist es von Hamburg in nur ein paar Stunden zu erreichen. Zudem wird ein großer Teil Dänemarks mit einbezogen.
Zu einer Zeit, wo immer mehr von abgehängten Randgebieten die Rede ist, setzt Dänemark auf die weniger bekannten Ortschaften und versucht Gäste dorthin zu locken und den Einheimischen etwas zu bieten.
Die bildende Kunst nimmt einen ziemlich großen Raum ein. Internationale Zugpferde wie Olafur Eliasson (darf in Dänemark, wo er aufgewachsen ist, eigentlich nie fehlen), Barbara Kruger und Thomas Hirschhorn werden mit weniger bekannten Namen kombiniert.
Gleich zu Anfang, ab 21. Januar, wird Signe Klejs für „Hesitation of lights“ eine zentrale Brücke in Aarhus in wechselndes Licht tauchen. Sie bezieht sich auf den dänischen Astronomen Ole Rømer, der herausfand, das Licht sich bewegt. Viele Besucher werden aber wohl eher an Eliassons bunte begehbare Installation auf dem Dach des nahen Museums Aros denken.
Randers wird mit seinem Gaia Museum für Outsider Art einbezogen und in Silkeborg eröffnet die Osloer Schau, die Asger Jorn und Edvard Munch zusammenbringt.
In Herning, nicht weit von der bei Surfern und Familien aus Deutschland so beliebten dänischen Nordsee wird die diesjährige Ausgabe der „Socle du Monde Biennale“ ins Programm einbezogen.

Auch das Dänemark fernab der Großstadt Aarhus wird mit ins Programm aufgenommen. (Foto: Bomsdorf)
Das dortige Kuratorenteam ist ganz anderen Biennalen würdig, so gehört dazu auch Daniel Birnbaum, früherer Venedig Biennale Kurator und jetzt Direktor des Moderna Museet in Stockholm. Die Biennale in Herning ist – der Titel lässt es erahnen – dem italienischen, aber etliche Jahre in Dänemark lebenden Piero Manzoni gewidmet. Der hat einst in Herning einen Sockel aufgestellt auf der die ganze Erdkugel ruhen soll. Im kommenden Jahr wird die Ausstellung sich dem Thema „Scheiße und Körper“ widmen. Das steht zwar so nicht offiziell im Programm, so fasste es im Gespräch in Aarhus aber eine Mitarbeiterin mit der vielen Dänen so üblichen bodenständigen Offenheit zusammen.
Wer die Liste der beteiligte Künstler anschaut, kann sich schon denken, warum sie die Thematik so zusammengefasst wird. Wim Delvoye wird sein künstliches Verdauungssystem „Cloaca“ zeigen und Pierre Manzonis „Merda d’artista“ gehört ohnehin zum örtlichen Museum.
Im Jorn Museum in Silkeborg wird ab Mitte Februar die Schau “Jorn + Munch” aus dem Osloer Munch Museum gastieren (zum Konzept der Ausstellungsserie mehr in meinem Artikel für The Wall Street Journal zur Ausstellung Melgaard + Munch).
Natürlich ist auch der in Dänemark aufgewachsene und in Berlin arbeitende isländische Künstler Olafur Eliasson mit von der Partie in Aarhus (nicht aber in Herning). Er ist durch seine Mitarbeit am Bühnenbild für das aus New York kommende Ballet „Tree of Codes“ vertreten. Tickets dafür versucht Aarhus 2017 seit Wochen wie ein Circus unter die Leute zu bringen, indem behauptet wird, es sei nun aber wirklich bald ausverkauft.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Der ältere, sehr ruhige sprechende, aber doch energische Herr, der mir vor etwas mehr als fünf Jahren in Breslau für eine gute Stunde zum Gespräch gegenübersaß, war mit Sicherheit einer der beeindruckendsten Interviewpartner, die ich je gehabt habe. Natürlich, weil er so klug war, aber nicht nur deshalb, sondern auch wegen seiner Milde und Nachdenklichkeit, wird mir Zygmunt Bauman und wird mir das Gespräch sicher auf ewig in Erinnerung bleiben. Dass die manchmal so vertrackte Autokorrektur des Computers aus seinem Nachnamen gerade Batman machen wollte, passt da. Die Künstlerin Shirin Neshat, die norwegische Königin – das sind zwei weitere Gesprächspartner, die lange nachwirkten.
Batman traf ich am Rande, schon wieder der dubiose Autokorrektur-Fehler. Also: Bauman traf ich während des Europäischen Kulturkongresses in Breslau 2011 (hier der Link zu seinem Abschlussvortrag). Ob Polen heute noch so eine Veranstaltung machen würde? Ich weiß es nicht. Baumans Wunsch von damals jedenfalls ist weiterhin aktuell: Zerschneiden wir den Gordischen Knoten, sagte er mir für das Interview in Die Welt:
“Der Konflikt zwischen Israel und Palästina ist ein gordischer Knoten. Er kann nicht gelockert werden. Wenn er zusammenbleibt, wird er nur fester. Wie Alexander der Große uns gelehrt hat, kann er nur durch Zerschlagen gelöst werden. Es ist ohne Frage sehr riskant, Palästina die Unabhängigkeit zu erlauben, denn das wird auf die eine oder andere Art zu einer neuen Front führen. Aber ich denke, das Risiko einer weiteren Verweigerung der Unabhängigkeit ist größer. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist geprägt von lebhafter Feindschaft, vom Unwillen, miteinander zu sprechen, Kompromisse einzugehen und so weiter. Wenn die aktuelle Situation beibehalten wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation.
Die Welt: Sie meinen, den Palästinensern Eigenständigkeit zuzusagen, würde den gordischen Knoten durchschlagen?
Zygmunt Bauman: Lasst es uns versuchen und den Palästinensern eine Stimme geben. Auch aus israelischer Sicht sollte es die bessere Lösung sein, denn zumindest haben die Palästinenser dann eine Wahl. Was sie dann machen, wird ihre Entscheidung als Staat sein. Sie werden dafür verantwortlich sein, was sie tun. Das sind sie jetzt nicht, denn sie sagen: ‘Wir sind besetzt, wir können nichts tun.’ Es geht hier nicht nur darum, palästinensische Wünsche zufriedenzustellen, sondern den Konflikt zu lösen. ”
Heute ist Zygmunt Bauman verstorben, der Konflikt aber dauert weiter an, ja, hat sich sogar verschärft. Auch seine Hoffnung für und seine Aufforderung an Europa, so richtig die Analyse natürlich ist, ist heute – Anfang 2017 – der Realisierung nicht näher gekommen:
“Der einzige Bereich, in dem Europa der Welt wirklich etwas bieten kann, ist die Kultur. Das meine ich in einem anthropologischen Sinne. Vielleicht sollte man besser von einer europäischen Zivilisation sprechen. Europa hat die schwere Kunst gelernt, jahrhundertealte Konflikte, Vorurteile und Feindschaften hinter sich zu lassen.”
Dieses Jahr, wo in Frankreich und in Deutschland gewählt wurde, auch nochmal Baumans Hinweis auf die zwei zentralen europäischen Akteure und ihre gemeinsame schreckliche Historie sowie positive Gegenwart:
“Europa kann dem Rest der Welt und vor allem dem Nahen Osten etwas bieten. Schauen Sie sich Frankreich und Deutschland an, heutzutage lieben diese Länder sich. Es ist also machbar und kein Wunder.”
Das ganze Interview erschien im September 2011 im Feuilleton von Die Welt und ist heut so lesenswert wie damals. Hier nochmal der Link zum Interview in Die Welt.
Noch ein letzter Ausschnitt, der ein wenig Vorlauf braucht und in dem Bauman so souverän mit möglichen Zuspitzungen von Journalistenkollegen umgeht, wie es häufiger sein sollte:
“Die Welt: Kürzlich haben Sie der polnischen Zeitung “Polityka” ein Interview gegeben, das auch in Deutschland Reaktionen hervorrief. Es geht vor allem um eine Passage. Da ich nur aus einer Übersetzung zitieren kann, korrigieren Sie mich bitte gegebenenfalls. Sie sagten, dass die von Israel erbaute Mauer …
Zygmunt Bauman: Da gab es eine Verzerrung. Ich wollte darauf hinaus, dass die Erinnerung an das Getto tief im jüdischen Bewusstsein ist. Ich überlegte, ob es den Regierenden in Israel in den Sinn gekommen wäre, eine Mauer zu bauen, wenn es dieses Trauma nicht gäbe. Immerhin haben Ihre Landsleute, die Deutschen, ihre Unannehmlichkeiten gelöst, indem sie eine Mauer gebaut haben und sich abgrenzten. Das Gleiche wurde von den Israelis mit der palästinensischen Mauer getan. Ich habe nicht impliziert, dass hinter der Mauer wie im Falle von Warschau Massenmord stattfindet. Die Israelis stellten fest: Hier sind Leute, mit denen wollen wir nicht kommunizieren, von denen wollen wir uns abgrenzen. Da kamen sie auf die Idee, eine Mauer zu bauen.
[…]
Die Welt: Günter Grass hat in einem Interview mit “Ha’aretz” kürzlich von sechs Millionen deutschen Kriegsgefangenen gesprochen, die in Russland ermordet worden seien. Das ist ihm zum Vorwurf gemacht worden.
Zygmunt Bauman: Ich habe davon gehört, aber das Gespräch nicht gelesen. Meine Worte sind verzerrt worden, also denke ich, da hat auch jemand seine Worte verzerrt. Solange ich es nicht von ihm gehört habe, möchte ich mich nicht dazu äußern. In jedem Fall stimmt es, dass der Krieg unglaublich unmenschlich ist. Das habe ich auch im Interview mit “Polityka” klargemacht, aber es ging dann leider unter: Ich bin besorgt über die moralische Verwüstung, die die Besetzung Palästinas bei den Israelis anrichtet, besonders bei Jüngeren, die direkt als Teil einer Besatzungsmacht geboren werden. Krieg ist für beide Seiten zerstörerisch, es gibt keine Sieger. Wer angefangen hat, ist eine andere Frage, aber sobald der Krieg einmal begonnen worden ist, gibt es auf beiden Seiten Opfer.
Die Welt: Eine solche Aussage heißt aber nicht, die Singularität des Holocaust infrage zu stellen?
Zygmunt Bauman: Nein. Der Holocaust war eine organisierte, bürokratische Operation mit klarem Zweck. Es waren keine spontanen Tötungen, es war organisiert und geschah über Jahre hinweg. Das Ziel war eines, das den Sowjets mit den deutschen Kriegsgefangenen nicht in den Sinn kam: die Vernichtung einer ganzen Nation und nicht nur des Militärs. Ich habe Günter Grass nicht gelesen, aber nehme nicht an, dass er eine Gleichsetzung im Sinn hatte. Vermutlich meinte er: ‘Ja, wir sind schuld am Holocaust, aber viele von uns sind auch ermordet worden’, und das stimmt. Es gibt bei einem Krieg nicht die Möglichkeit, dass eine Seite ohne Verluste bleibt. Deshalb muss Krieg ein für allemal beendet werden. Das ist genau das, was Europa dem Rest der Welt bieten kann.”
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Und hier steuert auch die Weltreporter-Zentrale einen Tipp bei: Wann immer wir wirklich inspiriertes und ziemlich schräges florales Design suchen, bei florales in Hamburg-Eimsbüttel werden wir fündig. Was sie können: Atmosphärische Bühnenbilder, literarische Charaktere und menschliche Temperamente in Blumen übersetzen, heitere Trauerkränze binden – oder einen spielfreudigen Adventskalender. Gelernt hat Eigentümerin Tanja Heesch u.a. bei Gregor Lersch, mit dem sie zum Beispiel in Japan gearbeitet hat (auch wenn unser nordeuropäischer Winter-Kranz diesmal eher nach Australien aussieht). Happy 4. Advent!

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.


Aktuelle Ausgabe der IP: Die Anti-Internationale (Foto: DGAP)
Ein kurzes Assoziationsspiel in 2 Schritten:
1. völkisch? – Völkischen Beobachter!
2. Völkischen Beobachter? – Nationalsozialismus!
Seit AfD-Chefin Frauke Petry im Interview mit der Welt am Sonntag gesagt hat, sie wolle den Begriff “völkisch” wieder positiver besetzen, gilt womöglich auch ein weiterer Schritt in der Assoziationskette, nämlich “völkisch? – Frauke Petry!”.
Fast jeder, der in Deutschland zur Schule gegangen ist, dürfte das Wort aus dem Namen des “Kampfblattes der nationalsozialistischen Bewegung Großdeutschlands” (so der Untertitel des “Völkischen Beobachters“) kennen.
“Völkisch” steht im Deutschen üblicherweise “für die Ausgrenzung von jedem, der nicht hier geboren wurde” so Kai Biermann in der Zeit, man könnte auch sagen für eine Ablehnung von allem was als undeutsch angesehen wird, als nicht mit dem angeblich vorhandenen Volkswillen vereinbar. Was wiederum schnell zur Populismus-Definition von Jan-Werner Müller führt und dem diese innwohnende “Vorstellung eines moralisch reinen Volkskörpers“.
Kurzer Schwenk gen Norden, nach Dänemark. Dort gibt es die Dansk Folkeparti (DF, Dänische Volkspartei), die ähnlich wie die AfD mancherorts, bei der Parlamentswahl im ganzen Land zweitstärkste Partei wurde.
„Völkischen Einfluss gibt es nur in Nationalstaaten, wo das Volk eine natürliche Zusammengehörigkeit fühlt“: So begründet die Dänische Volkspartei ganz offen auf ihrer Homepage ihre kritische Haltung zur EU. Natürlich muss hier angemerkt werden, dass das dänische “folkelig” verständlicherweise nicht die selben Assoziationen erweckt wie in Deutschland “völkisch”, doch ist es hier was Müllers Populismus Definition und Biermanns Worte angeht genauso gemeint, also abgrenzend gegenüber jenen, die nicht im Lande geboren sind und letztlich egal wie lange sie auch in Dänemark sind und ob sie den dänischen Pass haben, nie zum dänischen Volk gehören werden (was Rassismus zumindest sehr nahe kommt).
Obwohl nicht nur zweitstärkste Fraktion im Parlament, sondern auch größte Partei rechts der Mitte, weigert DF sich, Regierungsverantwortung zu übernehmen und treibt stattdessen die bürgerliche Minderheitsregierung vor sich her. Die Verschärfung des Asylrechts in Dänemark wäre ohne den Druck von rechts wohl kaum so strikt ausgefallen. Auch hätte die liberal-konservative Regierung, allen voran Integrationsministerin Inger Støjberg, wohl kaum so stark gegen Ausländer polemisiert wie zuletzt. Schon warnt Justizminister Søren Pind, selbst gelegentlich ein Scharfmacher, vor Parallelen zu den 1930ern – „auf ganz andere Weise, aber es ist einfach der gleiche Zorn, die gleiche Ohnmacht und es sind die gleichen Reaktionen“, sagte er im März 2016 im Interview mit der Zeitung Politiken. Was wird erst geschehen, wenn die Dänische Volkspartei einmal alleine an die Macht kommen wird?

Das neue Buch der Weltreporter. (Foto: Random House)
Der Blick gen Dänemark zeigt, welches Potential die Rechte hat, wenn sie bürgerlich auftritt und Dänemark zeigt auch, mit welch Ausgrenzung – rhetorischer und realer – selbst EU-Bürger konfrontiert werden können.
Ein Teil des obigen Textes erschien zuerst im von mir koordinierten Beitrag zum Weltreporter-Buch “Die Flüchtlingsrevolution”, mehr zu lesen gibt es auch in meinem Text in der Internationalen Politik, der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (online steht nur die gekürzte englische Version).
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Gestern ging die Weltreporter-Jahreskonferenz in Raiding, Österreich, zu Ende. Drei Tage tagten Weltreporter aus allen Kontinenten. Zur öffentlichen Diskussion am Samstag hatten wir neben Weltreportern wie Kilian Kirchgessner, Prag, und Karim El-Gawhary, Kairo auch Hasnain Kasim vom Spiegel zur Diskussion geladen. Ganz aktuell hier schon einmal ein Link zu dem Beitrag den das österreichische Fernsehen ORF zur Veranstaltung brachte [NB: Ab Ende Juli vermutlich nur noch hier bei YouTube zu sehen.].
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Nein, sie wird es nicht – als Update zu meinem Blogeintrag kürzlich: Lange hat sie hoffen dürfen, aber Helle Thorning-Schmidt wird nicht UN-Flüchtlingskommissarin. Auch der Deutsche Achim Steiner geht leer aus. Die dänische Ministerpräsdentin und der Bürokrat unterlagen beide gegen den Italiener Filippo Grandi.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Nein, sie wird es nicht – als Update zu meinem Blogeintrag kürzlich: Lange hat sie hoffen dürfen, aber Helle Thorning-Schmidt wird nicht UN-Flüchtlingskommissarin. Auch der Deutsche Achim Steiner geht leer aus. Die dänische Ministerpräsdentin und der Bürokrat unterlagen beide gegen den Italiener Filippo Grandi.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Eine internetaffine Überschrift für die dänische Selfie-Queen… Der UNHCR ist seit Monaten wieder einmal eine vielzitierte Institution, schließlich ist es jene UN-Einrichtung, die sich um die Flüchtlinge dieser Welt kümmert. Und die chronisch unterfinanziert ist, was mit zu den vielen syrischen Flüchtlingen beitrug wie Thomas Gutschker vor kurzem in der FAZ schrieb. Demnächst tritt der derzeitige UN Flüchtlingshochkommissar Antonio Guterres ab und von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt wird hinter den Kulissen bereits ein Nachfolger gesucht.
Offizielle dänische Kandidatin ist die ehemalige dänische Premierministerin Helle Thorning-Schmidt. Wegen ihrer strammen Asylpolitik erscheint die auf den ersten Blick wenig geeignet. Doch gerade das könnte ihr helfen gegen den Deutschen Achim Steiner zu gewinnen, schrieb ich kürzlich in Das Parlament.
„Wir haben die Asylregeln drastisch verschärft, als die ersten in 12 Jahren,“ sagte Helle Thorning-Schmidt im diesjährigen dänischen Wahlkampf. Unter anderem wurde der Familiennachzug erschwert.
Zwar verlor sie die Wahl, wurde aber vor kurzem von ihrem Nachfolger im Amt des Premiers als Chefin des UNHCR nominiert. Aus Deutschland kandidiert Achim Steiner, derzeit Chef des UN-Umweltprogramms.
Die strenge dänische Asylpolitik, die nach Thorning-Schmidts Abwahl im Sommer von ihrem Nachfolger weiter verschärft wurde, passt kaum zum UNHCR. Schließlich will der die Rechte von Flüchtlingen sichern und dafür sorgen, dass diese Asyl beantragen und eine sichere neue Heimat finden können. Dänemark hingegen wird vorgeworfen, Probleme auf die Nachbarländer Deutschland und Schweden abzuwälzen. Es gilt deshalb als „Ungarn des Nordens“.
Doch die strikte Haltung könnte Thorning-Schmidts Vorteil werden. Denn die Politiker vieler Länder stehen der dänischen Position näher als der deutschen. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Flüchtlingen, die weltweit Sicherheit und eine neue Heimat suchen, sehen sie sich und ihre Länder überfordert. Eine UNHCR-Chefin, die für eine restriktive Flüchtlingspolitik steht, wäre da – so widersprüchlich das auch klingen mag – womöglich gewünscht.
In ihrer Heimat allerdings regt sich Kritik daran, ausgerechnet Thorning-Schmidt zur Flüchtlingskommissarin zu machen. „Ernennt Steiner!“, überschrieb die linksalternative Zeitung Information einen Kommentar. Der deutsche Kandidat sei fachlich besser qualifiziert, hieß es. Und der Publizist Herbert Pundik kritisiert Thorning-Schmidts Asylpolitik als „kleinlich“. Angesichts dessen sei es jetzt allenfalls „opportunistisch“, wenn sie sich nun plötzlich für Flüchtlinge einsetzen werde.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
In den relativ bevölerungsarmen nordeuropäischen Ländern sind die Medien immer wieder ganz begeistert, wenn es darum geht zu berichten, wie sie im Ausland gesehen werden.
Es mag der kleine-Bruder-Komplex sein, vielleicht ist es aber auch einfach Weltoffenheit. Schon häufiger sind meine Text über die fünf Länder in den dortigen Medien zitiert worden und regelmäßig werde ich von Hörfunk- und Fernsehen gebeten, doch einmal zu sagen, wie denn Deutschland nun diese oder jene Entscheidung oder dieses oder jenes Ereignis sieht.
Häufig muss ich mein Statement um ein “so wirklich wahnsinnig groß interessiert das aber keinen” ergänzen.
So auch bei den diesjährigen dänischen Wahlen (über die ich für Das Parlament hier berichtet habe). Zweimal bat mich das öffentlich-rechtliche Radio Dänemarks, DR, ins Studio, um zu hören, wie denn in Deutschland die dänische Debatte verfolgt werde (wenig) und über was man besonders überrascht sei (dass die Einwanderung immer noch ein so großes Thema ist und das selbst die Sozialdemokraten bei diesem Punkt sehr populistisch geworden sind; dass die Wahl sehr spontan ausgerufen wird).
Nachzuhören sind die Beiträge von Mennesker og Medier (Menschen und Medien) hier und von Orientering (Orientierung) hier.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Mittendrin dann plötzlich die heikelste Frage von allen. Zuvor hatten wir den Umbruch in Ägypten diskutiert, die zunehmend repressiven Verhältnisse, die zerstörten Hoffnungen und den Wunsch vieler Ägypter nach Stabilität. Wir hatten versucht, etwas Klarheit in den Schlamassel zu bringen, so gut es eben ging. Wir beschäftigten uns mit Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt.
Aber länger überlegen musste ich erst, als der langjährige ARD-Korrespondent Jörg Armbruster von mir wissen wollte, ob ich mir vorstellen könnte, in Schwäbisch Gmünd zu leben. Was antwortet man auf solch eine Frage, wenn vor einem knapp hundert stolze Schwäbisch Gmünder sitzen, deren Stuhlreihen so angeordnet sind, dass sie den Fluchtweg versperren?
Natürlich kann ich mir vorstellen, dort zu leben. Schwäbisch Gmünd ist eine feine, mittelkleine Stadt mit herausgeputztem historischen Stadtkern, eine Idylle, die für jeden, der gerade aus Kairo kommt, einen Anblick bietet wie mit Photoshop bildbearbeitet. Außerdem hängt es ja von Tausendundeinem Grund ab, ob man an einem Ort zurechtkommt, allen voran von der Arbeit. (Und da ist Schwäbisch Gmünd für einen Nahostkorrespondenten leider eher weniger geeignet, auch wenn es in Nah-Ostwürttemberg liegt.)
Zusammen mit Jörg Armbruster und Suleman Taufiq, den Herausgebern des Stadtlesebuches »Mein Kairo – My Cairo«, war ich an einem Abend in der Stadtbibliothek des Ortes zu Gast und am darauffolgenden Abend dann im Buchhaus Wittwer in Stuttgart. Der großformatige, edel gestaltete Band mit Texten von rund 50 Autoren ist eine Liebeserklärung an die Millionenmetropole am Nil – der vermutlich einzige Kairo-Bildband, in dem die Pyramiden kein einziges Mal auftauchen, jedenfalls nicht in den 140 spannenden Photographien von Barbara Armbruster und Hala Elkoussy.
In meinem Text erzähle ich von meiner Zeit im ärmlichen, traditionellen Altstadtviertel Bab al-Shaariyya. Unter anderem berichte ich vom benachbarten Tischler, der mal ein geborstenes Wasserrohr in meiner Wohnung mit den Worten reparierte: »Wenn Gott will, dass dein Wasserrohr am Ende wieder ganz ist, dann kriege sogar ich das hin. Wenn Gott dies nicht will, dann schafft das auch kein richtiger Klempner.«
Besser kann man die Entspanntheit gar nicht beschreiben, mit der die Kairoer ihren Alltag am Ende doch immer irgendwie bewältigen. Gleichzeitig ist dieser Ansatz beunruhigend. Man stelle sich vor, der Tischler hätte mich mit denselben Worten am Blinddarm operiert: »Wenn Gott will, dass du den Eingriff überlebst, dann kriege sogar ich das hin. Wenn Gott dies nicht will, dann schafft das auch kein echter Chirurg.«
Infos zu dem dreisprachigen Stadtlesebuch/Bildband (deutsch, englisch, arabisch) auf der Webseite der edition esefeld & traub. Und so fand die Lokalpresse unseren Abend in Schwäbisch Gmünd.

Lesung und Diskussion im Buchhaus Wittwer in Stuttgart: Jörg Armbruster, Jürgen Stryjak, Suleman Taufiq
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Ich habe Angela Thompson getroffen um mit ihr ein Interview über Dresden zu machen.
Genauer gesagt geht es darum, wie sie als Dreijährige mit Mutter, Großmutter und kleiner Schwester aus den Flammen flüchtete.

Sie spricht darüber, wie sie in Bischofswerda ankamen und ein neues Leben aus dem Nichts aufbauten, wie sehr sie die Jungen Pioniere hasste und all den Zwang, der mit dem Leben in Ostdeutschland verbunden war. Dann kam die große Enttäuschung, als sie sich nach der Flucht in den Westen auch dort eingeengt fühlte und schließlich der Umzug in die DDR, immer verbunden mit der Sehnsucht nach Freiheit.
Fast nebenbei erzählt mir Angela, dass sie später in den 70 er Jahren zurück kam in die DDR und zwar jedes Jahr.
Sie hat dort Menschen geholfen, die wegen ihrer politischen Meinung, religiöser Überzeugungen oder kritischen Äußerungen unterdrückt wurden. “Ich wusste, dass das gefährlich war, aber ich konnte nicht anders,” sagt sie.
Wie bitte? Das MUSS sie mir genauer erzählen!
Angela Thompson hatte das dringende Bedürfnis, den Menschen in der DDR zu helfen.
Vor allem lag das daran, dass sie sich und ihre Eltern immer wieder gefragt hatte, warum niemand gegen Hitler aufgestanden war, warum niemand den Menschen geholfen hatte, die unter ihm unterdrückt wurden. Außerdem war sie sehr dankbar dafür, dass sie den Weg in die Freiheit gefunden hatte und ganz über ihr Leben bestimmen konnte.
“Plötzlich habe ich gewusst, dass ich doch von niemandem erwarten kann, dass sie etwas für Menschen in Schwierigkeiten tun, wenn ich selbst nicht den Menschen in der DDR helfe.”
Es begann mit dem Schmuggeln von Taschenrechnern, politischen Zeitschriften und Büchern für Verwandte und Freunde. Daraus wurde viel mehr. Angela Thompson fuhr mit dem Auto quer durch die USA nach Washington, um dort mit Senatoren und Vertreten des Außenministeriums über politische Gefangene zu sprechen. Die Abgeordneten versprachen, zu helfen. Sie telefonierte mit Präsidentschaftskandidat Ronald Reagan über einen besonders brisanten Fall. Auch er wurde aktiv.
Sie selbst übermittelte Informationen zwischen West und Ost, bog heimlich von der Transitstrecke ab, um sich mit Angehörigen der Gefangenen zu treffen.
Der Gefahr war sie sich immer bewusst. “Aber ich musste das einfach tun, weil das zum Menschsein dazu gehört.”
Sie erzählt mir das in ihrem licht durchfluteten Wohnzimmer. Im Regal hinterher viele deutsche Bücher, Reclamhefte und Schallplatten mit klassischer Musik. In Glasvitrinen Porzellan aus Meißen und Krippenfiguren aus dem Erzgebirge. Dazwischen eine Buddhafigur, Rosen aus dem Garten und moderne Kunst and den Wänden.
Man merkt die starke Verbindung zwischen ihr und der alten Heimat.
Niemals hätte ich geahnt, was sie für die Menschen dort riskiert hat.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Deutsche Truppen auf dänischem Boden – am heutigen 9. April ist es 75 Jahre her, dass Dänemark vom nationalsozialistischen Deutschland besetzt wurde. Die dänischen Medien nehmen das zum Anlass über die historische Bedeutung des Datums, das zu Dänemarks Historie gehört wie 1864 (die Niederlage auf den Düppeler Schanzen) und 1992 (der Sieg über Deutschland im Finale der Fußball-EM), zu diskutieren.
Schon ein paar Tage zuvor verkündete der öffentlich-rechtliche Sender DR, dass die Dänen die Deutschen nun lieben würden. Das war das Ergebnis einer aktuellen Umfrage kurz vor dem 75. Jahrestag. In der Tat ist die Deutschland- oder besser gesagt Berlin-Begeisterung seit einigen Jahren groß.
Viele Dänen haben eine Zweitwohnung in der deutschen Hauptstadt oder reisen dort zumindest ständig hin, in Kopenhagen ist es cool Deutsch zu sprechen und Läden und Bars mit deutschen Namen zu versehen. Darüber habe ich schon vor ein paar Jahren für Die Welt geschrieben und vor kurzem griff auch die dpa das Thema auf.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

… aus Nizamuddin in Neu Delhi. Diesen O-Ton haben wir aus einem Video herausgenommen, das Michael Radunski in Delhis Stadtteil Nizamuddin aufgenommen hat, in einem kleinen Hinterhof vor dem Mogul-Grab Chausath Khamba. Was wir hier hören ist “Qawwali”, ist ein zum Sufismus gehörender Gesangsstil, der ursprünglich aus der ehemaligen Provinz Punjab im heutigen Pakistan und Nordindien stammt.
Das Grab im Hinterhof wurde 1623 erbaut und hütet die Gebeine des Mogul-Kaisers Mirza Aziz Kokaltash. Der Name Chausath leitet sich von der impossanten Deckenkonstruktion ab, die auf 64 Marmorsäulen ruht (Chausath = 64). Seit 2011 wurde das Grabmal mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Delhi restauriert und nun feierlich mit Qawwali-Gesang für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Michael hat das Video extra für den Adventskalender aufgenommen.
Bevor Michael 2012 nach Neu Delhi kam, hat er in England und China gelebt. In seinen Reportagen, Interviews und Porträts erzählt er nun von einem Land, das ihn durch seine Unterschiedlichkeit fasziniert.
(Fotos: co Deutsche Botschaft Neu Delhi/German Embassy New Delhi)
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wer hätte das gedacht? Da werde ich am selben Tag zweimal an den Duft der DDR erinnert – und das mitten in Los Angeles! Einmal steigt er mir sogar direkt in die Nase!
Er kommt aus einem Kontrollhäuschen aus Ost-Berlin, das an einer Kreuzung in Los Angeles steht. Wenn man nah ran geht riecht man den Geruch der DDR, der aus allen Ritzen kriecht: die unverkennbare Mischung aus Reinigungsmitteln, Staub, verbrannter Kohle und deprimierender Unterdrückung.

ADN-Pförtnerhaus ist das Projekt von Künstler Christof Zwiener. Er hat das Haus vor der Metallpresse gerettet und in Berlin auf zwei Quadratmetern mehrere Installationen kuratiert.
Nach Los Angeles kam es durch Initiative des Wende Museums, das seit über zehn Jahren Strandgut aus den ehemaligen Ostblock-Staaten sammelt und archiviert. Christof erklärt: das Häuschen riecht selbst nach mehreren Installationen und einer Containerreise noch nach DDR weil es über 11 Jahre lang ungelüftet auf dem Parkplatz des ehemaligen ADN-Gebäudes stand. Da hatte der Geruch richtig schön Zeit, sich festzusetzen.
Am selben Tag, an dem ich diese unerwartete Dosis DDR einatme, erzählt mir der Komponist, Arrangeur und Dirigent Chris Walden aus Hamburg von genau diesem “Duft”. Walden ist seit 18 Jahren in Hollywood und arbeitet inzwischen mit den größten der Musikszene, von Barbra Streisand bis Michael Buble. Gerade hat er mit seiner eigenen Big Band eine CD herausgebracht ‘Full On!’. Gleichzeitig arrangiert er für Stevie Wonder und Josh Groban Songs, hat vor wenigen Wochen ein selbst komponiertes Arrangement für Neil Youngs erste Orchesterplatte dirigiert.
Und wieso hat Chris Walden auch noch diesen DDR-Geruch in der Nase?
In den 90er Jahren arrangierte und dirigierte er mit der RIAS Big Band. Sie arbeiteten immer in den Studios in West Berlin, bis der RIAS – Rundfunk im Amerikanischen Sektor – 1994 mit Ost-Funkstationen zusammen gelegt wude. Da ging es ab nach Karlshorst, in die Räume der Nalepastraße. Eine Geisterstadt, in der die Band zwischen Spinnweben, zerbrochenen Scheiben und eben diesem Duft ihre Stücke einspielte.
“Gespenstisch, surreal und urig,” erinnert sich Walden.
Am 8. November gibt es beim Wende Museum eine große Party zur Feier des Mauerfalls. Da steht dann auch das ADN-Pförtnerhaus im Hinterhof. Ich werde so viele wie möglich hinlocken und auffordern, mal ganz tief einzuatmen: Das war der Geruch der DDR.
Und hier noch ein link zu einer Geschichte über das Pförtnerhaus, die ich für das Deutschlandradio produziert habe
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Der längste zusammenhängende Mauerstreifen außerhalb von Deutschland ist – in Los Angeles, auf einer Wiese neben dem Wilshire Boulevard, einer Hauptverkehrsstrecke zwischen West und Ost, gegenüber vom Los Angeles County Museum of Art. Mittags parken hier ein halbes Dutzend Food Trucks, oft sind einer mit Bratwurst und die Currywurst-Konkurrenz dabei.
Die zehn Originalsegmente aus Berlin hat das Wende Museum zum 20. Jahrestag des Mauerfalls nach Los Angeles gebracht. Inzwischen gab es davor Demonstrationen und Picknicks, Konzerte und Hochzeiten.
Viele Fragmente der Berliner Mauer sind in Nordamerika gelandet. Zwei kanadische Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, zumindest einen Teil von deren Geschichte aufzuspüren und zu dokumentieren. Ihr Projekt heißt Freedom Rocks. Letzte Woche haben Vid Ingelevics und Blake Fitzpatrick dafür Station im Goethe Institut von Los Angeles gemacht.
Vor schlichter Kulisse von Klappstuhl und Tisch mit schwarzer Decke stellten sie Kamera und Scheinwerfer auf. Dann kamen die Besitzer von Mauerfragmenten und erzählten ihre Geschichten.
Die Künstler stellen immer dieselben Fragen: Wie heißt Du? Wo wohnst Du? Woher hast Du die Mauerstücke? Wo bewahrst Du sie auf? Was bedeuten sie heute für Dich?
Sie filmen nur Hände, die die Fragmente halten und haben festgestellt, dass die meisten Geschichten weniger mit dem Kalten Krieg als mit persönlichen Erinnerungen zu tun haben.

In Los Angeles erzählt ein Deutschprofessor, wie er 1990 mit Studienkollegen in einer Regennacht Stücke selbst abklopfte. Ein Künstler berichtet, wie er einen Teil der Mauer in Kreuzberg 1987 bemalte, ganau zwei Jahre bevor die Grenze geöffnet wurde. Eine Teilnehmerin ist nicht sicher ob ihre Teile echt sind. Sie hat sie in einem Baumarkt für 20 Dollar gekauft. Einer Germanistin aus Dresden steigen Tränen in die Augen, als sie erzählt wie sie eine Woche nach dem Fall der Mauer zum ersten Mal im Leben durch das Brandenburger Tor ging und von dort Mauerstücke mit nach Los Angeles nahm.
“Solange die Fragmente in Bewegung ist wird sich ihre Geschichte verändern,” fassen die Künstler zusammen. “Wie wir uns an Geschichte erinnern und ihr Denkmale setzen bleibt nie gleich.”
Meine Geschichte für den Deutschlandfunk können Sie hier nachhören: Freedom Rocks
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Seit Juli 2011 ist Jürgen Klinsmann Coach der US-Nationalmannschaft. Sein Anfang war etwas holprig, voller Experimente und deshalb auch mit einigen schwachen Spielen. Doch im Gegensatz zum Rest der Welt, wo das zur Ruck-Zuck-Entlassung des Trainers geführt hätte, bekam in den USA kaum jemand was mit vom schwachen Start. Die Stadien waren halb leer, nur eine Handvoll Reporter – davon mehr als die Hälfte von hispanischen Medien – berichtete darüber und die raren Fernsehübertragungen der Spiele schaltete sowieso kaum jemand ein. Trotzdem gab es einen Spieleraufstand – die alteingesessenen Profis fühlten sich übergangen und US-Spieler insgesamt ungerecht benachteiligt gegenüber Neuzugängen mit doppelter Staatsbürgerschaft aus Zentralamerika und Europa.
Doch jetzt ist alles anders und viel besser im US-Fußball, der hier ‘soccer’ genannt wird. 16 Mal haben die USA während der WM-Qualifikation gewonnen, davon zwölf sogar in Serie am Stück. Das gab’s noch nie in der Verbandsgeschichte. Sie haben den Gold Cup gewonnen und sich frühzeitig für die WM qualifiziert. Halb leere Stadien gibt es nicht mehr. Dafür sorgen die ‘American Outlaws’ – eine Fanorganisation, die vor ein paar Jahren von 40 Fans in Nebraska gegründet wurde. Ländlicher als Nebraska geht’s eigentlich nicht mehr. Football mag man da und NASCAR-Autorennen. Fußball? Das ist was für Weicheier! Deshalb auch der Name ‘Outlaws’ – Außenseiter ja! Weicheier nein! Zu jedem Spiel der Nationalelf reisen sie, inzwischen zu Tausenden. Insgesamt haben sie über 17 tausend Mitglieder in rund 150 Ortsverbänden. Gemeinsam marschieren sie von der Vor-Party auf dem Parkplatz in die Stadien, singen stehend 90 Minuten lang patriotische Fußballsongs – und LIEBEN Jürgen Klinsmann.
https://soundcloud.com/soundslikerstin/we-want-j-rgen-us-soccer-coach
Beim ausverkauften Freundschaftsspiel gegen Süd Korea hab ich das selber miterlebt. Mehr Stimmung gibt’s auch in deutschen Stadien nicht. Von den Fans, die ich dort getroffen habe, werden mehr als 600 nach Brasilien reisen, um das Team bei der WM anzufeuern. Die Outlaws haben Flugzeuge gechartert und Hotelzimmer reserviert, um der Nationalelf gemeinsam zu folgen. Auch das ist eine absolute Neuheit für den US-Sport. Das gab’s noch nie im Fußball und gibt es in keiner anderen Disziplin. Football, Basketball, Baseball, Eishockey haben starke lokale Fanclubs. Bei Olympischen Spielen können Basketball und Eishockey Patriotismus wecken, aber rund ums Jahr einer Nationalmannschaft hinterherreisen? Das gibt’s sonst nirgendwo.
Dass es so gut aufwärts geht mit dem US-Fußball hat auch viel mit dem Trainer zu tun, da sind die Fans sicher. Klinsmann öffnet Türen – zu Spielen auf höchstem internationalem Niveau, zu Spielern im Ausland, die ins US-Nationalteam wollen und zu Veränderungen im System, die Nachwuchs fördern. Deshalb lieben sie ihn.
Am 26. Juni trifft Klinsmanns Elf auf die von seinem ehemaligen Ko-Trainer Joachim Löw. Klinsi sagt: er wird beide Hymnen singen aber danach ist für 90 Minuten Schluß mit der Freundschaft. Er will nichts lieber, als an dem Tag Deutschland besiegen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Es begann bei einer Party, erzählt mir Cornelia Funke bei einem Espresso im Büro von Thomas Gaehtgens, dem Leiter des Getty Research Centers. Einer Party, zu der sie eigentlich gar nicht gehen wollte, weil die super erfolgreiche Schriftstellerin gar nicht auf Hollywood-Partys steht. Aber sie ließ sich überreden.
“Und wen sehe ich als Erstes kaum komme ich zur Tür rein?” Der Ton legt nahe, dass es sich um ein dreiköpfiges, schielendes, sabberndes Monster am Buffet handeln muss. Wenn nicht schlimmer!
“Brad Pitt!”
“Aha!” denke ich, ich habe Cornelia missverstanden. Sie war dann doch froh, dass sie zur Party gegangen ist. “Nein!” widerspricht sie und verdreht die Augen. Dieser Anblick bestätigte nur dass es eine Feier genau der Sorte sein würde, der sie möglichst aus dem Weg geht. “Aber Brad Pitt sieht ja auch tatsächlich von Nahem sehr gut aus und ist auch sehr nett!” fügt sie dann noch hinzu.
Viel wichtiger war aber die Begegnung mit Gaehtgens. Mit dem sprach sie über ihre Bücher und deren Charaktere aus verschiedenen Jahrhunderten, über Projekte, Inspirationen und Schwierigkeiten beim Schreiben. Der Leiter des Research Institutes lud sie sofort ein, das Getty-Archiv zu nutzen. Das Institut ist offen für jede Form der Recherche.
Mehrere Notizbücher hat sie inzwischen gefüllt mit Fotos von Charakteren des Getty-Archivs: furchterregend, verführerisch, geheimnisvoll, bucklig, zart, klein, kostümiert, nackt… Sie alle erweckt sie in ihren Büchern zu neuem Leben. Wann immer Funke ins Institut kommt, liegen da schon neue Bücher bereit. Als Dank für Offenheit und Hilfe des Instituts erfand Cornelia Funke den Piraten William Dampier. Genauer gesagt: Dampier lebte tatsächlich von 1651 bis 1715. Dank Funke spukt er jetzt als Geist durch die weiße Getty-Festung über dem Pazifik. Sie hat eine Piraten-Geschichte erfunden rund um Landkarten, Sternenkarten, Silbermünzen, Muscheln und Mumien für die jungen Besucher der neusten Ausstellung des Instituts: ‘Connecting Seas – A Visual History of Discoveries and Encounters’. Die folgt Reisenden, Neugierigen, Abenteurern, Erfindern, Aufschneidern, Wissenschaftlern, Kolonialisten und Ausbeutern über die Weltmeere vom 17. Jahrhundert bis heute.
Mir gaben die beiden eine Tour durch die Ausstellung. Ziemlich beeindruckend! Nicht nur, was ich da zu sehen bekam sondern auch, wie die beiden ganz unkompliziert und unbürokratisch mit Hilfe von mehreren Kuratoren das Projekt auf die Beine gestellt haben.
Der Geist von Pirat Dampier soll auch in Zukunft durch Austellungen spuken und Kinder in den Bann von Forschung und Geschichte ziehen. Die Broschüre mit seiner Geschichte liegt kostenlos aus und auch Erwachsene nehmen sie gerne mit.
Die Show zur Erkundung des Globus über die Weltmeere ist noch bis zum 13. April offen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Ausgerechnet im sauberen Deutschland hat sich mein Sohn Würmer eingefangen. Im Sandkasten, auf dem Spielplatz oder im Kindergarten, keiner weiß es so genau. Es fing an mit einem leichten Jucken am Popo und endete mit einem mehrwöchigen Drama durchwachter Nächte, wiederholtem Waschen sämtlicher Bettwäsche, Schlafanzüge, Unterhosen und Stofftiere sowie diversen Kinderarztbesuchen. Durchaus auch in gemäßigten Breitengraden nichts Ungewöhnliches, wie ich während der Prozedur gelernt habe, meist durch Übertragung von Tieren. Zwar hatte im Kindergarten angeblich sonst niemand Würmer, praktisch gesehen allerdings ein Ding der Unmöglichkeit bei der hohen Übertragbarkeit. Aber über so etwas reden Eltern – zumindest in Deutschland – wohl lieber nicht. So ähnlich wie bei Läusen: Während in Frankreich die bewährten Läusemittel in der Apotheke gleich vorne im Regal stehen, muss man sie sich in Deutschland mit gesenkter Stimme aus den Tiefen des Lagers holen lassen.
Wie auch immer: Bei der dritten Behandlung hat die verabreichte Wurmkur endlich gewirkt und der Spuk war mit einem Schlag beendet. Bei den ersten beiden Versuchen musste der dreijährige Patient ein widerlich riechendes, giftrotes Medikament hinunterwürgen, das ihm zwei Stunden später (also bereits nach Wirkungseintritt) wieder hochkam. Leider bekämpfte das Zeug nur den gemeinen Madenwurm und hat die Viecher im Darm meines Sohnes offensichtlich nicht beeindruckt. Erst beim dritten Wurmalarm bekamen wir ein Rezept für das verschreibungspflichtige Medikament Helmex, das gegen diverses Gewürm wirkt. Besonders lecker roch die schleimige Suspension ebenfalls nicht. Um Wiederansteckung vorzubeugen, hat die ganze Familie inklusive Oma mitgeschluckt. Und musste selbst bezahlen: 24 Euro pro Person.
Als wir wenig später wieder nach Indonesien reisten und der Kinderpopo dort schon wieder juckte, rannte ich sofort panisch in die nächste Apotheke. Mitten im Raum, nicht zu übersehen, stand in allen möglichen Packungsgrößten und Verabreichungsformen das Medikament Combantrin. Jedes Kind in Indonesien kennt die kleinen Plastikfläschchen, die idealerweise alle halbe Jahr vorbeugend verabreicht werden sollten. Der Sirup schmeckt in etwa wie flüssige Gummibärchen und kaum ein Kind weigert sich, dies zu trinken. Kosten für eine Erwachsenendosis: umgerechnet 70 Cent. Für die gleiche Menge desselben Wirkstoffs wie bei den in Deutschland verkauften Medikamenten.
Die vermeintliche, erneute Wurmattacke stellte sich glücklicherweise als Fehlalarm heraus. Stattdessen habe ich mich nun vor der nächsten Heimreise mit billigen, rezeptfreiem Wurmmittel eingedeckt.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Der Reiseführer hatte gewarnt. „In the region is the Bavarian lookalike town of Leavenworth…People come from all over the country to see the spectacle“. Es klang nach einer Art Disneyland, nach Brezelbuden und Achterbahn mit Zwiebeltürmchen. Wenn man zum ersten Mal in Washington State unterwegs ist, muss man sich so einen Kitsch wirklich nicht antun, dachte ich. Aber dann war der Highway, den ich nehmen wollte, wegen eines Erdrutschs gesperrt, und so kam ich doch noch nach Leavenworth.
Es muss recht harmlos begonnen haben, in den 1960er Jahren, als sich die Kleinstadt zusätzliche Einnahmequellen jenseits von Holz- und Landwirtschaft erschließen wollte. Pauline und Owen Watson, die einen kleinen Laden an der Hauptstraße betrieben, hatten Solvang besucht, eine kalifornische Siedlung, die dänische Einwanderer zu einem Mini-Kopenhagen umgebaut haben. Das Modell leuchtete den Watsons ein. Flugs wurde ein Komitee gegründet namens LIFE – Leavenworth Improvement For Everyone – und die Umwidmung der Stadt erörtert. Dabei kam heraus, dass sich die Bergstadt Leavenworth viel besser mit Weißwurst und Fachwerk vermarkten lässt als mit kleiner Meerjungfrau und Andersens Märchen. Der Stadtumbau wurde begonnen.
Seit damals hat Leavenworth als bayerische Alpenstadt ein beachtliche Authentizität erreicht. Von wegen Achterbahn und Brezelbuden: Dies ist kein Vergnügungspark. Die komplette Innenstadt wurde als Kreuzung von Mittenwald und Berchtesgarden neu geboren, mit hölzernen Balkons, Fassadenmalerei, einschlägigen Restaurants, Biergärten, Kutschen und einem Nussknackermuseum. Viele Einwohner kleiden sich in Dirndl und Lederhosn. Auch einen Maibaum gibt es und im Herbst, natürlich, ein Oktoberfest.

Sogar die Lokalzeitung hat sich dem Stil angepasst: Sie heißt „The Leavenworth Echo“ und trägt im Logo ein Edelweiß sowie einen Alphornbläser in Lederhosn.
Es ist eine so perfekte Verwandlung, dass ich mich unwirklich fühlte, wie in einem Film. Ich wusste, dass ich mich im Nordwesten der USA befand, unweit von Seattle, in einem Ort, in dem ich nie zuvor gewesen war. Gleichzeitig wurde ich Opfer der Illusion; eine Stimme in meinem Inneren flüsterte mir unablässig zu: Du kennst das hier!
Kommerziell ist die Transformation von Leavenworth ein großer Erfolg. In dem 2000-Einwohner-Ort gibt es heute mehr als hundert Hotels und dutzende „uriger“ Gaststätten.
Die Transformation wirft Fragen von weitreichender Bedeutung auf. Ist bayerischer Kitsch weniger schlimm, wenn er in Mittenwald stattfindet als in Leavenworth? Kann die Kopie einer Lebensart besser sein als ihr Original? Sollte Bayern sein Kulturgut urheberrechtlich schützen lassen, und müsste Leavenworth dann Lizenzgebühren zahlen? Deutet sich hier womöglich sogar ein ganz neuer Ansatz zur Lösung der europäischen Krise an – ein Kompletttransfer der Akropolis ins Niemandsland von Nevada oder der spanischen Alhambra nach Idaho?
Fotos: Christine Mattauch
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
 Manchmal ist doch wunderbar, wenn die Welt klar, kompakt und Entscheidungen einfach sind. Ich zb wüßte genau, was ich machen würde, wenn ich am 1. August um 20 Uhr nicht in silly Sydney, sondern ausnahmsweise circa 16500 Kilometer weiter nördlich wäre: Ich würde in die Rudi-Dutschke-Straße 23 in BerlinKreuzberg radeln, mich im taz-Café an einen schattigen Tisch setzen, zuhören, am Kaltgetränk nippen und viel und laut lachen.
Manchmal ist doch wunderbar, wenn die Welt klar, kompakt und Entscheidungen einfach sind. Ich zb wüßte genau, was ich machen würde, wenn ich am 1. August um 20 Uhr nicht in silly Sydney, sondern ausnahmsweise circa 16500 Kilometer weiter nördlich wäre: Ich würde in die Rudi-Dutschke-Straße 23 in BerlinKreuzberg radeln, mich im taz-Café an einen schattigen Tisch setzen, zuhören, am Kaltgetränk nippen und viel und laut lachen.
Dann und dort nämlich lesen drei Weltreporter aus ihren extrem kurzweiligen Büchern: Anke Richter (Christchurch), Kerstin Schweighöfer (Den Haag) und Martin Zöller (Rom/München) lassen bei ihrer Culture-Clash Lesung übrigens auch mit sich reden und diskutieren. Das Motto des Abends ist sommerlich freudvoll alliteriert und geht so: “Mafia, Maori und Maasdamer”. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken 😉 es wird garantiert ein urkomisch vergnüglicher Abend! Viel Spass und gute Unterhaltung!
Ps: der Eintritt ist übrigens frei.