Netzwerk
Mitglieder
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.


Bettina Rühl bekommt das Bundesverdienstkreuz
Die Korrespondentin wird damit für ihre „unabhängige, überdurchschnittlich engagierte und bemerkenswerte Recherche-Arbeit” in Afrika und ihre Berichterstattung über Afrika ausgezeichnet. Vorgeschlagen hatte sie Bundesaußenminister Heiko Maas, mutmaßlich höchstpersönlich Fan von Bettinas Reportagen, Hintergründen und Analysen.
 Bettina Rühl berichtet seit über zwanzig Jahren über Afrika. Ihre Features, Reportagen und Berichte werden in verschiedenen Programmen des ARD-Hörfunks gesendet, in Magazinen und Zeitungen gedruckt. Außerdem vertritt sie regelmäßig die ARD-Hörfunkkorrespondentin für Ostafrika und arbeitet bisweilen fürs Fernsehen.
Bettina Rühl berichtet seit über zwanzig Jahren über Afrika. Ihre Features, Reportagen und Berichte werden in verschiedenen Programmen des ARD-Hörfunks gesendet, in Magazinen und Zeitungen gedruckt. Außerdem vertritt sie regelmäßig die ARD-Hörfunkkorrespondentin für Ostafrika und arbeitet bisweilen fürs Fernsehen. Bettina Rühl ist nicht die einzige Weltreporterin, der diese Ehre zuteil wird. Arndt Peltner, seit einem Jahr Weltreporter in Oakland, USA, wurde 2004 für seine Arbeit mit Radio Goethe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Peltner habe es geschafft, mit dem Musikprogramm junge Menschen in den USA für Deutschland zu interessieren und fördere die Freundschaft zwischen jungen Menschen in den beiden Ländern, hieß es in der Begründung. Peltner war vor 16 Jahren einer der jüngsten Träger des vom Bundespräsidenten vergebenen Verdienstordens.
Bettina Rühl ist nicht die einzige Weltreporterin, der diese Ehre zuteil wird. Arndt Peltner, seit einem Jahr Weltreporter in Oakland, USA, wurde 2004 für seine Arbeit mit Radio Goethe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Peltner habe es geschafft, mit dem Musikprogramm junge Menschen in den USA für Deutschland zu interessieren und fördere die Freundschaft zwischen jungen Menschen in den beiden Ländern, hieß es in der Begründung. Peltner war vor 16 Jahren einer der jüngsten Träger des vom Bundespräsidenten vergebenen Verdienstordens.Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
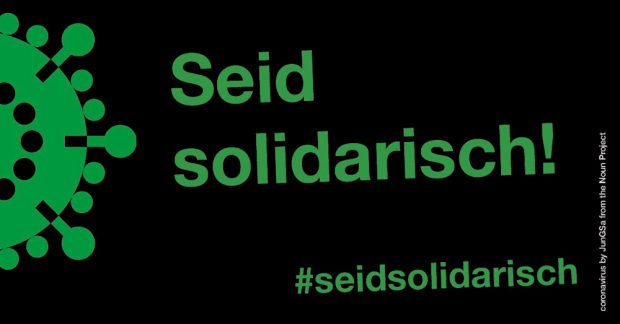
weltreporter.net schließt sich dem Aufruf der Freischreiber, dem Berufsverband freier Journalisten und Journalistinnen, an:
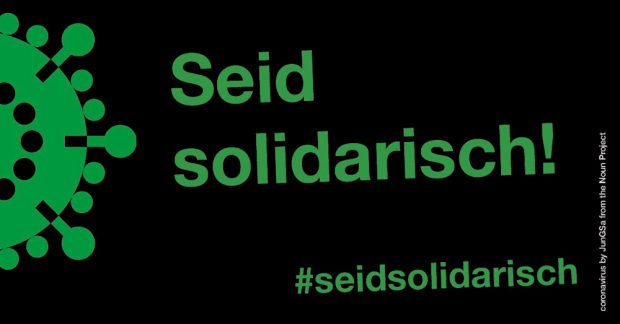
Ausfallhonorare zahlen, Ersatzaufträge anbieten, Absicherung freier Journalist*innen verbessern: weltreporter.net appelliert an die Solidarität der Redaktionen mit ihren freien Journalist*innen.
Wir freien Journalist*innen sind eine tragende Säule der deutschen Medienlandschaft. Wir versorgen die Öffentlichkeit mit gut recherchierten Informationen. Wir berichten aus aller Welt. Sprechen mit Expert*innen und tragen die Fakten zusammen, verifizieren, überarbeiten – oft rund um die Uhr. Weil wir unseren Job lieben, weil wir um unsere Verantwortung wissen, weil wir unseren Teil dazu beitragen wollen, auch diese Krise gemeinsam zu meistern.
Gleichzeitig ist die Krise für viele freie Journalist*innen eine existenzielle Bedrohung: Veranstaltungen und Interviews werden abgesagt, vereinbarte Beiträge zu anderen Themen durch die Berichterstattung über die Pandemie verdrängt. Die Folge: massive Umsatz- und Einkommensausfälle, und das in einer Situation, in der freie Journalist*innen vielfach bei voller Arbeit nur weniger als halb so viel wie festangestellte Redakteur*innen verdienen. Die Bildung von Rücklagen ist so nur kaum möglich, siehe Freischreiber-Honorar-Report.
Aus diesem Grund appellieren wir an die Auftraggeber*innen: Helft euren freien Kolleg*innen mit schnellen und unkomplizierten Zahlungen, rechnet Beiträge, die nun verschoben werden, schon jetzt ab. Und zahlt freien Journalist*innen, die einen Termin nicht wahrnehmen können, weil Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden, unkomplizierte Ausfallhonorare.
Helft ihnen auch, wenn eine Veranstaltung zwar stattfindet, der oder die Kolleg*in sie aber nicht wahrnehmen kann, weil Schulen oder Kindergärten geschlossen haben und die Kinder betreut werden müssen. Habt ein offenes Ohr für eure Freien. Seid solidarisch!
Ihr Redaktionen und Verlage da draußen – jetzt ist der Moment, über den Code of Fairness hinauszuwachsen. Gebt euren freien Kolleg*innen Ersatzaufträge. Lasst uns die Zeit gemeinsam dafür nutzen, neue Formate zu entwickeln. Eure Freien sind oft Top-Expert*innen in ihren Themen. Nutzt das! Für Webinare, für Video-Konferenzen, für Projekte, die schon lange in euren Schubladen liegen. Schiebt sie jetzt an. Ein Gutes hat die Krise: Der Wert von gutem Journalismus wird jetzt endlich wieder wahrgenommen. Nutzen wir das zum Positiven. Halten wir zusammen. Euer Geld, unsere Expertise. Waschen wir uns die Hände und packen es gemeinsam an.
Aufruf als PDF.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Maßnahmen lockern? Anders forschen? Alte Menschen isolieren? – Debatten, die in Deutschland geführt werden, beschäftigen auch andere Länder. Aber es gibt dort auch völlig andere Lösungen, Ansätze und Konflikte. Die Weltreporter berichten in diesen Wochen von allen Kontinenten fast ausschließlich über Situationen, Menschen und Ereignisse, die irgendwie mit Covid-19 zu tun haben.
Falls Sie eine C-Verschnaufpause brauchen: Manche Themen – wie Cornelia Funkes neuer Roman, über den Kerstin Zilm im Deutschlandfunk Kultur spricht – haben weniger inhaltlich als vielmehr anlässlich mit Corona zu tun: Die Bestsellerautorin Funke lässt in den kommenden Wochen live auf Instagram und YouTube aus dem vierten Buch ihrer Tintenwelt-Serie lesen. Das Buch ist noch gar nicht veröffentlicht. Funke erzählte Kerstin Zilm, warum sie die ersten 14 Kapitel von ‘Die Farbe der Rache’ trotzdem schon aus ihrer Schublade geholt hat.
In Taiwan wurden die ersten Coronavirus-Infektionen noch vor jenen in Deutschland gemeldet, doch bis heute gibt es in dem asiatischen Land weniger als 450 Infektionen und sechs Tote – Wie gelingt eine so beeindruckende Bilanz? Nicht ohne Einschränkungen, aber mit raschen, wirksamen Maßnahmen hat der Inselstaat vor der Küste Chinas geschafft, die Ausbreitung des Virus unter den 23 Millionen Einwohnern stark einzudämmen. Einen spannenden Bericht dazu hat Klaus Bardenhagen für die Umschau des MDR gefilmt.

Klaus Bardenhagen berichtet aus Taipei Foto: Screenshot mdr
Dort erklärt er – diesmal auch vor der Kamera – warum Taiwan in diesen Tagen so eine Art Insel der Seligen ist. Über die strenge Heimquarantäne und die besondere Rolle der Taxifahrer in Taiwan hatte Klaus Bardenhagen zuvor bereits mit dem ARD Studio Tokio für das Mittagsmagazin einen Beitrag gedreht.
Knapp 10.000 Kilometer weiter südwestlich arbeitet Anke Richter, die sich in den vergangenen drei Wochen kaum wie Kollege Bardenhagen auf einem vor Menschen wimmelnden Markt getummelt haben dürfte. In Christchurch wurde der Lockdown mit deutlich härteren Sanktionen durchgesetzt als in vielen deutschen Städten. Und Neuseeland liegt jetzt im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus mit einem Reproduktionsfaktor von 0,5 vorne. Als sonderlich harsch wurden die Maßnahmen dort jedoch von vielen nicht empfunden. “Nett und schlau” nennt Anke in ihrer Story für Zeit Online die Strategie, mit der der Pazifikstaat bisher offenbar gut fährt. Regierungschefin Jacinda Ardern sitzt dort im Sweatshirt zu Hause und beantwortet im Livechat auf Facebook Fragen ihrer Landsleute – unprätentiös, herzlich, sachkundig.
Während anderswo Mediziner fehlen, schickt Kuba Doktoren in die Welt: 596 Ärztinnen und Ärzte habe man in insgesamt 14 Länder entsandt, um sie zu unterstützen, hieß es aus dem kubanischen Gesundheitsministerium. Wie es dazu kam, dass sich der sozialistische Inselstaat in der medizinischen Kooperation derzeit so profiliert, hat Wolf-Dieter Vogel analysiert.
Singapur hatte die Krise fast im Griff. Doch jetzt schockiert ein massiver Ausbruch in den Wohnheimen für ausländische Arbeiter den reichen Stadtstaat, schreibt Mathias Peer im Handelsblatt. Zwar gehört Singapur zu den reichsten Ländern der Welt, doch bei ihren Gastarbeitern sparen viele Unternehmen wo es geht – das rächt sich nun offenbar.

Ein Straßenhändler in Kenia verkauft Desinfektionsmittel © Bettina Rühl
Den afrikanischen Kontinent hat das Coronavirus mit Verzögerung erreicht. Inzwischen steigen die Infektionszahlen deutlich an. In Kenia, Uganda, Simbabwe und Südafrika greifen Polizei und Militär hart durch, um Ausgangsbeschränkungen durchzusetzen. Im Deutschlandfunk berichten Bettina Rühl und Leonie March über die Situation in Slums der kenianischen Hauptstadt und über das zum Teil drastische Krisenmanagement Südafrikas.
Julia Macher erzählt in ihrer Hörfunk-Reportage auf Deutschlandfunk Kultur wie Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in Barcelona mit der Corona-Krise umgehen. Das war für die Weltreporterin in Spanien auch eine erzählerische Herausforderung: Wie bleibt man trotz Ausgangssperre und „social distancing“ nah dran an den Protagonisten?
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Corona-Krise hat noch wichtiger gemacht, was uns Weltreporter auszeichnet: Wir sind schon da, wohin andere erst reisen müssen – und genau das jetzt nicht mehr können. Quarantäne, geschlossene Grenzen, Reisebeschränkungen, Ausgangssperren – Reisen sind schwierig geworden, nicht nur ins Ausland, und auch für Journalisten. Wer zum Coronavirus jenseits der Landesgrenzen recherchieren will, schaut ins Internet, telefoniert – oder beauftragt einen Weltreporter. Wir wissen, wie die Situation in vielen Regionen der Welt ist, denn wir arbeiten und leben dort.
Fabian Kretschmer berichtet aus China zur Öffnung der Stadt Wuhan und beschreibt, welche Auswirkungen die Krise auf die Blase des chinesischen Profifussballs hat. Anke Richter hat mit Deutschen gesprochen, die in Neuseeland festsitzen.
Sarah Mersch beobachtet, wie die Tunesier daraf reagieren, wenn Ausgangssperren plötzlich mit Drohnen überwacht werden. Wolf-Dieter Vogel schreibt aus Mexiko, weshalb ein Essayband mit philosophischen Texten in der Coronakrise offenbar einen wichtigen Nerv trifft.
Vermutlich schon, schreibt Julia Macher, aus dem Brennpunkt-Land Spanien. Sie arbeitet in Barcelona und berichtet von dort unter anderem darüber, was sich Hotels einfallen lassen, wenn Touristen fehlen.

Bettina Rühl und Marc Engelhardt recherchieren im dem Kongo und in Genf, wie die Ebolakrise zu Ende geht – und was sich für die Corona-Pandemie daraus lernen lässt.
Bettina Ruehl weiß außerdem, wie ein gespensticher Flughafen aussieht, sie war im Terminal von Nairobis Airport, als dort die letzten internationalen Flüge landeten. Im Deutschlandfunk berichtet sie an diesem Wochenende gemeinsam mit Südafrika-Weltreporterin Leonie March und anderen Korrespondenten über die Situation in Afrika.
Wie sich das Virus in Townships und Slums in Südafrika ausbreitet, schildert Leonie March außerdem in einem Korrespondentengespräch mit dem SWR.
Warum die Australier derzeit nicht sonderlich gut auf Kreuzfahrer zu sprechen sind – und wie es aussieht wenn Strände geschlossen werden – habe ich in einem kurzen Länder-Update zusammengestellt. In Brüssel fragt sich Eric Bonse, wann die EU-Staaten den “Exit” aus der Coronakrise vorbereiten?

So aktuell wie es uns möglich ist, halten wir Weltreporter Sie aus mehr als 100 Ländern auch über unsere Weltreporter.net-Facebookseite und unseren Twitter-Kanal auf dem Laufenden.
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie demokratisch, bleiben Sie informiert.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.


Das größte Netzwerk freier deutschsprachiger Auslandkorrespondenten feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben die „Weltreporter“ nach vorne geblickt – mit einer Diskussion zum Stand und zur Zukunft des Auslandsjournalismus. Dem Netzwerk gehören inzwischen rund 50 Korrespondentinnen und Korrespondenten an, die aus mehr als 160 Ländern berichten.
Im ausverkauften Grünen Salon der Berliner Volksbühne folgten über 100 Gäste der Diskussion unter dem Titel „Das drohende Verschwinden der Welt“. Qualitativ hochwertige Auslandsberichterstattung hat es zunehmend schwer. Schuld daran sind das Mediensterben in Deutschland, Sparvorgaben in den Redaktionen und Auslagerung von Risiken auf die Schultern der Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wie kann angesichts dieser Ausgangslage die Zukunft aussehen?
Die Welt sei so unübersichtlich und schnell geworden, dass selbst gestandene Korrespondenten sie nicht mehr verstünden, räumte Jochen Wegner, Chefredakteur von „Zeit Online“ und Mitglied der Chefredaktion von “Die Zeit” zum Auftakt der Debatte ein. Bettina Rühl, Vorsitzende der „Weltreporter“ hielt dagegen: Tatsächlich sähen Korrespondenten oftmals Krisen voraus, nur würden Berichte über solche Entwicklungen von immer weniger Redaktionen veröffentlicht, bevor ein offener Konflikt ausgebrochen sei. Das Ergebnis: Die Öffentlichkeit werde immer häufiger von Ereignissen vermeintlich überrascht, die für Deutschland auch politisch und wirtschaftlich relevant seien.
Der klassische Korrespondent bleibt unentbehrlich
Für Journalist und Medienwissenschaftler Lutz Mükke bleibt der klassische Korrespondent unentbehrlich. Zwar könnten interessierte Leserinnen, Hörer oder Zuschauer durch soziale Netzwerke auf eine Vielzahl direkter Quellen zugreifen. Allerdings könnten nur Korrespondenten mit Ortskenntnis die Brückenfunktion übernehmen, die zur Einordnung und Vermittlung von Geschehnissen im Ausland gebraucht werde – gerade dann, wenn sich Ereignisse zu überschlagen scheinen. Dies werde jedoch schwierig, wenn man sich vor Augen halte, dass zum Beispiel in Subsahara-Afrika in den vergangenen Jahren mehr als ein Fünftel der Korrespondentenstellen deutschsprachiger Medien abgebaut wurden. Das Reisebudget sei sogar halbiert worden, so Mükke.
In diesem Zusammenhang „sehe ich eine große Zukunft für Netzwerke wie die Weltreporter, weil wir uns keine umfassenden Korrespondentennetzwerke mehr leisten können“, räumte Zeit-Chefredakteur Jochen Wegner ein.
Marcus Bensmann, Mitglied des Rechercheverbunds Correctiv, plädierte für die stärkere Nutzung der Möglichkeiten, die sich durch das Internet und die soziale Medien eröffnen. „Es gibt bei den Menschen eine erkennbare Sehnsucht nach Informationen und nach dem Verstehen der Welt.“ Bei dem stiftungsfinanzierten Modell von Correctiv würden zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzer mit einbezogen und an Recherchen beteiligt.
Bettina Rühl bei der Podiumsdiskussion in der Volksbühne

„Das Internet ist nicht nur eine Bedrohung, sondern bietet auch Chancen für eine breitere Berichterstattung“, erklärte Bettina Rühl. Bislang sei darüber allerdings die Finanzierung hochwertigen Journalismus kaum möglich. Das zu ändern, gehört zu den, Zielen des Netzwerks für die nächsten Jahre. „Wir wollen uns an die geänderten Bedingungen anpassen, ohne unsere zentralen Ansprüche aufzugeben“, betonte Bettina Rühl: „qualitativ hochwertige Berichterstattung und beste Ortskenntnis“.
Die Veranstaltung wurde unterstützt von torial.com, der Online-Plattform für JournalistInnen, und der Deutschen Post DHL Group.
Fotos: Rainer Stosberg
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Weltreporter haben ihren 15-jährigen Geburtstag gefeiert – stilecht mit einer Diskussion zum Stand des Auslandsjournalismus. Im ausverkauften Grünen Salon der Volksbühne folgten mehr als 120 Gäste der Diskussion auf der Bühne. Die Überschrift: “Das drohende Verschwinden der Welt”. Qualitativ hochwertige Auslandsberichterstattung hat es schwer. Gründe dafür: Mediensterben in Deutschland, Geldnot in den Redaktionen, Auslagerung von Risiken auf die Schultern der Korrespondenten. Wie kann angesichts dieser Ausgangslage die Zukunft aussehen?

Über Lage und Zukunft des Auslandsjournalismus diskutierten (v.l.) Bettina Rühl (Vorsitzende Weltreporter), Lutz Mükke (Reporter und Medienwissenschaftler), Marcus Bensmann (Correctiv) und Jochen Wegner (Chefredakteur Zeit online).
Die Welt sei so unübersichtlich geworden, dass selbst gestandene Korrespondenten sie nicht mehr verstünden, sagte der Chefredakteur von Zeit online, Jochen Wegner, zum Auftakt der Debatte. Die Vorsitzende der Weltreporter, Bettina Rühl, hielt dagegen: Tatsächlich sähen Korrespondenten oftmals Krisen voraus, nur wolle die Berichte darüber kaum jemand drucken, solange es nicht knallt. Christina Schott (Weltreporterin in Indonesien) bestätigte diese Einschätzung: Die schleichende Islamisierung in Südostasien etwa werde weitgehend ignoriert, trotz der drohenden Eskalation.

Die Journalistin Anke Bruns (ganz rechts) moderierte die Runde zum 15. Geburtstag der Weltreporter.
Marcus Bensmann (Correctiv) plädierte für die stärkere Nutzung von sozialen Medien: Klassische Mediennutzung werde von sozialen und elektronischen Medien abgelöst, letztlich könne jeder Journalist und Leser sein – vorausgesetzt, er wisse, wie Journalismus funktioniere. Als Beispiel nannte Bensmann die Reporterfabrik des stiftungsfinanzierten Recherchenetzwerks Correctiv.
Für den Reporter und Medienwissenschaftler Lutz Mükke bleibt der klassische Korrespondent unentbehrlich. Nur er könne die Brückenfunktion übernehmen, die zur Vermittlung von Geschehnissen im Ausland gebraucht werde.

Volles Haus im Grünen Salon der Volksbühne
Eine junge Journalistin fragte sich nach der Debatte: Soll ich Auslandskorrespondentin werden? Der Rat der Weltreporter: Unbedingt. Es gibt kaum einen spannenderen Job als den, aus den Ausland zu berichten. In diesem Sinne erhoben Weltreporter und Publikum zum Abschluss der Debatte die Sektgläser: Auf die nächsten 15 Jahre!
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Diskussion am 26. Oktober 2019 um 19 Uhr im Grünen Salon der Volksbühne Berlin.
Was im Ausland passiert, hat unmittelbare Folgen für uns und unser Leben in Deutschland. Korrespondenten schlagen die Brücke zwischen dem, was in der Ferne wichtig ist, und dem, was heimische Leser, Zuhörer und Zuschauer interessiert. Doch dieses Modell ist gehörig ins Wanken gekommen – die Folge: ein zunehmend verzerrtes Bild von der Welt.
Medienhäuser dünnen ihre Korrespondentennetze seit Jahren aus, unter ihnen auch die wichtigen Nachrichtenagenturen. Immer häufiger werden Auslandsberichte in deutschen Redaktionen geschrieben. Im Krisenfall fliegen Redakteure an Hotspots, wo sie wenig mehr tun können, als sich ihre Vorurteile bestätigen zu lassen, wenn sie überhaupt ins Land kommen. Autoritäre Staaten wie die Türkei verweigern Berichterstattern die nötige Zulassung oder – wie in China – Reisegenehmigungen innerhalb des Landes. Wo Berichterstattung schwierig oder teuer ist, bestimmen interessengeleitete Organisationen oder Individuen, was wir wissen. Selbst Tweets ungeklärter Herkunft gelten gegen alle journalistischen Grundsätze zu oft als Quelle.
Dieser Trend ist auch deshalb beunruhigend, weil Bundesregierung und Bundeswehr als Akteure in internationalen Krisen gefragt sind. So sitzt Deutschland seit diesem Jahr im Weltsicherheitsrat, ist Teil von Blauhelmmissionen. Bürgerinnen und Bürger müssen den Sinn von Interventionen beurteilen können. Dafür braucht es qualitativ hochwertige, journalistisch saubere und langfristig angelegte Berichte von Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. Ihre Arbeit ist unerlässlich.
Das gilt besonders, weil die Glaubwürdigkeit von Medien – nicht nur in Deutschland – immer massiver zum Politikum gemacht wird. Das Label „fake news“ ist zu einer beliebten rhetorischen Figur geworden, mit der die Argumente des politischen Gegners vom Tisch gewischt werden. Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten gründlich recherchieren und „sauber“ berichten, egal aus welchem Winkel der Erde. Dafür braucht es Ressourcen.
Weil die aber häufig fehlen oder anderswo eingesetzt werden, bekommt die deutsche Bevölkerung ein zunehmend verzerrtes Bild der Welt präsentiert.
Was kann und muss also unternommen werden, um fundierte und unabhängige Auslandsberichterstattung in Deutschland zu garantieren? Welche Verantwortung tragen Redaktionen, Korrespondenten, Herausgeber? Was muss die Bundespolitik tun, um für die Freiheit der Auslandsberichterstattung zu streiten? Welche neuen Modelle brauchen wir, um gründliche und unabhängige Berichterstattung künftig finanzieren zu können?
Diese und andere Fragen diskutieren Redakteure, Wissenschaftler, Korrespondenten und das Publikum bei unserer Veranstaltung anlässlich des 15. Geburtstages der “Weltreporter”, des größten Netzwerkes freier Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten aus dem deutschsprachigen Raum.
Teilnehmer: Bettina Rühl (Weltreporter), Jochen Wegner (Chefredakteur Zeit online), Marcus Bensmann (correctiv), Lutz Mükke (Reporter und Medienwissenschaftler). Moderation: Anke Bruns.
Unterstützt wird die Veranstaltung von torial.com, der Online-Plattform für JournalistInnen, und der Deutschen Post DHL Group.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Wir sind rund 50 Korrespondenten, die aus 160 Ländern berichten. Uns trennen tausende Kilometer und sämtliche Zeitzonen: Wenn Seoul schlafen geht, steht Los Angeles gerade auf. Um die zeitliche und räumliche Distanz zu überwinden, treffen wir uns einmal im Jahr in Deutschland, um die wichtigsten Themen zu besprechen und vor allem um den gemeinsamen Geist zu spüren, der uns verbindet – ganz real und ohne virtuelle Schranken.

Dieses Jahr fand das Treffen vom 14. bis 16. September in Köln statt. Ein Höhepunkt war die Vorstellung unseres neuen Buches „Ausgeschlossen“ mit anschließendem Empfang im Excelsior Hotel Ernst – zu dem wir gemeinsam mit dem Kölner Presseclub und dem Kölner Stadtanzeiger eingeladen hatten. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Reaktionen überwältigend, die Bücher ausverkauft. Herzlichen Dank an das tolle kölsche Publikum!
Foto: Christian Ahrens
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Der Axel-Corti-Preis ging dieses Jahr an Weltreporter Karim El-Gawhary. Bei seiner Dankesrede für den österreichischen Fernsehpreis der Erwachsenenbildung erinnerte der Nahost-Korrespondent daran, dass sich niemand aussucht, wo er geboren wird und welchen Pass er dadurch zufällig erhält. Die meisten Menschen auf dieser Welt können nicht hinreisen, wo sie wollen. Sie haben auch keinen freien Zugang zu unabhängigen Medien. Daher empfindet El-Gawhary es als „unheimlich großes Privileg öffentlich-rechtlich für Sie alle zu arbeiten, sozusagen Ihnen allen zu gehören“. Und ruft dazu auf, dass wir uns dieses Privileg von niemandem wegnehmen lassen sollten.
Link: https://www.facebook.com/weltreporter/videos/2439909616025424/
Mehr News, Geschichten und Anekdoten von den Weltreportern erfahren Sie in unserem monatlichen Newsletter
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Weltreporter sind in fast allen Zeitzonen zu Hause. Das hilft uns bei der Arbeit, sorgt für Aufträge, kann aber auch für Verwirrung sorgen. Welche das sind, erzählen unsere Reporter auf einer 20-minütigen Reise um die Welt, aus Regionen, in denen die Uhren oft gründlich anders ticken als in Berlin oder in Bremen. Im vierten Podcast der Weltreporter geht es um Zeit – um Rhythmus, Ungeduld und Warten, um Verschiebung der Zeit und ihren Wert. Ein Dutzend Reporter nehmen Sie mit auf einen sehr persönlichen Ausflug in ihren Alltag und an Orte, von denen wir sonst für Sie – Leser und Hörer – in deutschen Medien berichten.
Weltreporter schreiben und recherchieren nicht nur auf sechs Kontinenten, einige von uns nutzen die Zeitverschiebung, die diese Arbeit mit sich bringt auch für Jobs, die es vor fünf Jahren noch gar nicht gab. Christina Schott hätte, als sie als Journalistin nach Indonesien zog, nie gedacht, dass ausgerechnet die Zeitverschiebung ihr mal eine familienfreundliche Arbeitszeit verschaffen würde. Wie viele Kollegen in der Region sorgt sie mehrere Tage im Monat an einem online Newsdesk dafür, dass die Webseiten großer deutscher Tageszeitungen 24 Stunden aktuell bleiben. Und wenn dann kurz vor ihrem Feierabend ein Vulkan spuckt, bricht bei ihr kein Stress aus – dann übergibt sie an die Frühschicht in Berlin oder Frankfurt.

Zug verpasst? Das kann in den Niederlanden Folgen haben…
“Meine Arbeitstage in Seoul sind oft endlos lang”, sagt hingegen Fabian Kretschmer, und er sagt auch, warum das so ist und er eigentlich nichts dagegen hat. Der Südkoreakorrespondent erinnert außerdem an einen historischen Moment, in dem in seiner Region die Uhr zum politischen Theater wurde, und eine halbe Stunde kurzfristig die Weltpolitik durcheinander brachte.
Möge dir Zeit übrig bleiben
Kerstin Zilms Großmutter wünschte der Enkelin in Kalifornien einst, ihr möge Zeit übrig bleiben. Auf Kerstins “Auf Wiedersehen” reagierte die alte Dame gerne mit einem “so Gott will und die Heiligen einstimmen.” Ein Spruch, den Jürgen Stryjak in Kairo in ähnlicher Variante fast häufiger hört als ein “Guten Morgen”; denn zur präzisen Zeiteinschätzung gehört in Ägypten das Inschallah إن شاء الله – so Gott will. Ob beim Schraubeneinkauf oder im Kebab-Restaurant – der Herrgott hat bei der Verwirklichung von Wünschen offenbar seine Hände im Spiel. In Stryjaks Wahlheimatstadt, die den Korrespondenten zuweilen an eine Science-Fiction-Vision aus dem Filmklassiker “Blade Runner” erinnert, kann die Formel “In schā’a llāh” sogar Einfluss auf das Tragen eines Sicherheitsgurtes haben…

Benjamin Wamocho studiert Tiermedizin und unterrichtet Musik in Nairobi
Gott hat den Europäern die Uhren gegeben und den Afrikanern die Zeit – diesen Spruch zitieren Afrikaner gerne, wenn mal wieder ein Europäer ausflippt, weil jemand Stunden nach dem vereinbarten Termin kommt. Bettina Rühl, die auch nach 30 Jahren Arbeit in Afrika noch zuweilen mit dem dortigen Zeitverständnis hadert, hat in Kenia einen Experten für Zeit und Rhythmus befragt: einen Musiker. Benjamin Wamocho erklärt ihr wunderbar, warum nicht immer schlecht sein muss, wenn man eher spürt, wann es Zeit für etwas ist, als ständig die Zeiger eines Geräts bestimmen zu lassen.
Ungeduld ist die Tugend des Korrespondenten
Marc Engelhardt, der von der Schweiz aus die Entscheidungen des UN-Sicherheitsrates verfolgt, muss bei der Arbeit mit einem anderen Aspekt der Zeit zurechtkommen: “In der in Diplomatie ist Zeit auch Macht”, weiß er. Je länger etwa in New York über Syrien-Sanktionen verhandelt wird, um so mehr Menschen sterben im Bombenahgel in Ostgutha. “Warten können mag eine Tugend der Diplomaten sein – Ungeduld ist die Tugend des Korrespondenten”, sagt Marc Engelhard.

Bei Kerstin Zilm in Los Angeles ticken die Uhren anders, erst recht zur Oscar-Zeit
Folgen Sie uns auf dieser akustischen Reise, und freuen Sie sich auf einige überraschende Erkenntnisse:
Wie tickt Los Angeles und wann ist der richtige Moment für eine Hochzeitsparty in Tunesien? Wie unterscheiden sich die südafrikanischen Gummizeiten right now von just now und now now? Weshalb schüttelt Christine Wollowski in Brasilien immer noch den Kopf und verabredet sich Tina Schott längst nicht mehr an Straßenecken? Welche Folgen kann ein verspäteter Zug im superpünktlichen Holland haben, und wie genau klingt die Schafszeit in einem südfranzösischen Dorf? – Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr hören Sie im Weltreporter Podcast #4, zusammengestellt von unserem Podcast-Team in fünf Zeitzonen: Kerstin Zilm, Birgit Kaspar, Jürgen Stryjak, Sascha Zastiral und Leonie March.
PS: Sie haben unsere ersten Podcast-Ausgaben über Licht und Identität verpasst? Sie finden Sie nach wie vor in der Soundcloud und natürlich auf unsere Homepage.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Es sind hunderte von Artikeln und stundenlanges Audiomaterial, die wir Weltreporter laufend mit unseren Berichten aus allen Kontinenten produzieren. Die meisten großen deutschsprachigen Medien greifen für ihre Auslandsberichterstattung auf „Weltreporter“ zurück. Damit erreicht unsere Arbeit in Deutschland sehr viele Menschen und bringt ihnen ferne und nahe Länder nah. Im digitalen Zeitalter sind journalistischen Produkte ebenso leicht zugänglich wie oftmals vergänglich – schließlich ist alles von fast überall her abrufbar und wird ständig um Neues ergänzt. Wir Weltreporter schätzen dieses breite Informationsangebot und tragen gerne dazu bei.
Jetzt halten wir aber einmal inne und bieten etwas zum In-der-Hand-halten: unser neues Weltreporter-Magazin „Rekorder“.

Das neue Magazin der Weltreporter (Foto: Bomsdorf).
Auf 200 Seiten haben wir Reportagen, Analysen und Interviews unserer Mitglieder gesammelt, die über das Ersterscheinungsdatum hinaus Relevanz haben. Denn gute Texte haben es verdient, mehr als einmal gedruckt zu werden. Guter Journalismus hat es verdient, den Spalten der Tageszeitungen und Magazine entnommen und in anderer Form erneut publiziert zu werden.
Ein Dutzend Texte von Mitgliedern der Weltreporter in dieser Form erneut zu veröffentlichen zeigt, was Auslandsberichterstattung im Allgemeinen und wir Weltreporter im Besonderen können: Geschichten erzählen, die neue Perspektiven auf die Welt eröffnen und damit vielleicht auch das eigene Leben.
Das Magazin ist im Weltreporter-orange gehalten und wurde von der Frankfurter Agentur very gestaltet. Wir bringen es bei Redaktionsbesuchen in den kommenden Monaten mit. Neben dem Podcast ist es unser zweites neues Medienangebot. Federführung bei dem Projekt haben die Weltreporter Sarah Mersch (Tunesien) und Clemens Bomsdorf (Nordeuropa).
Sollten Sie noch keins bekommen haben und können nicht länger warten, wenden Sie sich an magazin@weltreporter.net, um schon jetzt ein Exemplar zugeschickt zu bekommen (begrenztes Kontingent).
Hier, auf unserem Blog, werden wir in den kommenden Monaten in unregelmäßigen Abständen auch einen kurzen Einblick ins Magazin geben und einzelne Texte daraus vorstellen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

„Gone bush“ heißt es in meiner Abwesenheitsnotiz, denn ich verbringe den Sommerurlaub wie jedes Jahr in unserem Hauslaster-Domizil an der wilden Westküste. Der steht hoch oben auf einem dicht bewachsenen Hang über tosendem Meer. Solarstrom, Plumpsklo, kein Internet, kein Handyempfang. Das ist Segen und Fluch, mal wieder.
Es war vor exakt sechs Jahren, als ich mich auf dem Fahrrad die steile Küstenstraße entlang bis zum nächsten Café in Punakaiki quälte, um dort einen Blick auf die Zeitung vom Vortag zu erhaschen. So aktuell sind dort die Auslieferungszeiten. Dafür kann man immer mit Sandfliegen rechnen. Solch kleine Mankos machen sie dort mit einmaliger Whitebait-Pizza und singenden Einheimischen wett, die jeden Freitag bis in die Puppen musizieren.
So kam es, dass ich als Letzte im Lande erfuhr, was dem bekanntesten wie dicksten Deutschen in Aotearoa widerfahren war: Kim Dotcoms Villa außerhalb Aucklands war in einer Großrazzia, wie sie das Land noch nie gesehen hatte, gestürmt worden. Der Hausherr saß im Knast – und die Auslandskorrespondentin am schönsten Arsch der Welt, weit von jedem Flughafen oder WLAN-Anschluss entfernt. Tage verbrachte ich telefonierend in dem Café, sah viele Touristen kommen und gehen und bekam am Ende eine halbwegs seriöse Geschichte zustande.
Jedes Mal, wenn ich das Pancake Rocks Café betrete, fällt mir kurz der von Dotcom versaute Urlaub ein. Und jedes Mal schwöre ich, dass sich solche Tiefpunkte statistisch nicht wiederholen können. Denn Januar ist Sommerpause, da ruht das kiwianische Leben komplett. Nicht ganz. Ein Leben begann längst woanders – im Bauch unserer neuen Premierministerin. Jacinda Ardern, keine drei Monate im Amt, und zack-bumm, schwanger. Ja, Wahnsinn! Eine Weltnachricht. Und ich mal wieder in seliger Unerreichbarkeit im Busch.
Darüber lachten wir dann alle beim letzten Grillen vor dem Hauslaster. Stießen auf unsere coole PM an, die das babytechnisch sicher alles gewuppt kriegt. Sonnten uns als eingewanderte Spät-Kiwis in dem Glanz, mit Jacinda ein bisschen internationalen Eindruck gemacht zu haben, auch wenn mein medialer Beitrag dazu bis dato noch fehlte. Bis unser frisch angereister Gast, der früher an dem Tag Empfang hatte, einen Schluck vom Bier nahm und beiläufig sagte: „Aber dass Kim Dotcom gerade wieder geheiratet hat und den neuseeländischen Staat in Milliardenhöhe verklagen will, das weißt du?“
internationalen Eindruck gemacht zu haben, auch wenn mein medialer Beitrag dazu bis dato noch fehlte. Bis unser frisch angereister Gast, der früher an dem Tag Empfang hatte, einen Schluck vom Bier nahm und beiläufig sagte: „Aber dass Kim Dotcom gerade wieder geheiratet hat und den neuseeländischen Staat in Milliardenhöhe verklagen will, das weißt du?“
Der MegaUpload-Krösus, dessen schillernde Laufbahn gerade in einem dollen Dokumentarfilm beleuchtet wurde, hatte ausgerechnet den Jahrestag seiner Verhaftung für die zweite Hochzeit gewählt – um, wie er twitterte, etwas Schlechtes in Gutes verwandeln. Nach wie vor schlecht für mich. Welch ein Sommer. Schlagzeilen sprudeln in die Welt, die zusammen eine halbe „Bunte“ füllen könnten, und ich habe nichts als eine Buschtrommel. Ich bin dann mal Wellenreiten.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Vor einer Woche sah es so aus, als stünde ein Ausbruch des Gunung Agung, des größten Vulkans auf der indonesischen Insel Bali, unmittelbar bevor. Drei Tage lang fand sich der heilige Berg der balinesischen Hindus in den Weltmedien wieder, wo er kurzfristig zum größten Vulkan Indonesiens aufstieg (in Wirklichkeit gehört er nicht einmal zu den Top Ten im Land mit den meisten Vulkanen der Welt). Als die Behörden vergangenen Montag die höchste Alarmstufe ausriefen, mussten fast hunderttausend Bergbewohner aus eine Zehn-Kilometer-Zone rund um den Berg evakuiert werden. Natürlich wurde das in den meisten Berichten auch kurz erwähnt. Das Hauptaugenmerk lag allerdings auf den ausländischen Touristen, die auf der beliebten Ferieninsel „festsitzen“, weil der Flugverkehr aufgrund der Aschewolken aus dem Vulkan eingestellt worden war. Für viele ein recht komfortables Intermezzo, da sich die meisten großen Reiseveranstalter kulant zeigten und Hotelbuchungen in den sicheren Touristenzentren kostenlos verlängerten.

Gunung Agung zu ruhigeren Zeiten
Weil sich der Vulkan nun offenbar doch noch etwas Zeit lässt mit seinem Ausbruch, konnten die Touristen nach zwei Tagen Reisesperre wieder abfliegen. Hätten sie übrigens auch vorher gekonnt – zugegebenermaßen mit einigem Mehraufwand – indem sie per Mietauto, Bus oder Bahn zum nächsten Fährhafen und von dort auf eine der Nachbarinseln übergesetzt hätten. Denn auch auf Java und Lombok gibt es internationale Flughäfen.
Die Bewohner des Gunung Agung dagegen sitzen weiterhin fest. Der Berg hat sich zwar etwas beruhigt, aber brummelt weiter. Kein gutes Zeichen: Die Vulkanologen warnen davor, dass sich im Inneren des Stratovulkans immer mehr Druck aufbaue, weil unter dem brodelnden Magma, das bereits im Krater zu sehen ist, Gase eingeschlossen seien. Obwohl immer noch höchste Alarmstufe besteht, fahren die Bauern mittlerweile wieder in die Evakuierungszone, um ihre Tiere zu füttern, um ihre Felder zu bestellen. Sie halten es nicht aus, einfach nur in überfüllten Turnhalten oder feuchten Zeltlagern herumzusitzen und abzuwarten. Ganz davon abgesehen, dass es dort nicht annähernd so bequem ist wie selbst in den einfachen Hotels der Touristenzentren im Süden Balis.

Die balinesischen Bergbauern sind diejenigen, die der Ausbruch des Gunung Agung wirklich betrifft. Doch der Berg ist ihnen heilig, auch wenn er ihnen Angst einjagt. Wo jetzt Asche und Geröll ihre Ernte zerstört, wird später besonders fruchtbare Erde entstehen. Deswegen werden sie bleiben und wieder von vorne anfangen. Und beten, dass die Götter ihnen dabei helfen. Und vielleicht auch ein wenig die Touristen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.


Khadija Ismayilova (Foto: Right Livelihood Award)
Journalistenpreise gibt es viele, Nobelpreise wenige. Und dann gibt es da noch den Alternativen Nobelpreis des Schweden Jakob von Uexküll, offiziell heißt die Ehrung Right Livelihood Award. In diesem Jahr wird damit unter anderem eine Journalistin ausgezeichnet: Adija Ismayilova aus Aserbaidschan. Das hat auch mit Deutschland zu tun.
Ismayilova erhält die Auszeichnung „für ihren Mut und ihre Hartnäckigkeit, Korruption auf höchster Regierungsebene durch herausragenden investigativen Journalismus aufzudecken“, wie es seitens des Right Livelihood Awards heißt. “Ich nehme die Auszeichnung im Namen aller Journalisten und Verteidiger der Menschenrechte in meinem Land an, die trotz schwierigster Bedingungen unermüdlich weiterarbeiten”, lässt sich Ismayilova zitieren. Als Weltreporter wissen wir, es braucht mehr dieser Journalisten. Überall.
Laut Right Livelihood Award ist “Khadija Ismayilova ist die bedeutendste investigative Journalistin Aserbaidschans. In den vergangenen zehn Jahren hat ihre Berichterstattung den Umfang der korrupten und lukrativen Geschäfte der herrschenden Elite Aserbaidschans dokumentiert, in die auch Familienmitglieder von Präsident Aliyev involviert sind.
Sie hat Beweise für Korruption auf höchster Regierungsebene gefunden, die auch multinationale Unternehmen wie TeliaSonera betrafen. Ihre Recherchen und Dokumentationen zeigen auf, wie der Reichtum der Nation geplündert und ins Ausland geschleust wird. Mit dem Geld werden zum Beispiel europäische Politiker beeinflusst, wie der aktuelle Fall der CDU-Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der Deutsch-Südkaukasischen Parlamentariergruppe Karin Strenz zeigt: Die Politikerin äußerte sich gegen hohe Zahlungen aserbaidschanischer Lobbyfirmen positiv über das Regime, lobte im Gegensatz zur OSZE-Beobachtermission die Wahlen 2010 und stimmte als einzige deutsche Abgeordnete im Europarat gegen eine Resolution zur Freilassung politischer Häftlinge in Aserbaidschan. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte Ismayilova: “Solche Leute ermöglichen es dem Regime, unsere Freiheit zu unterdrücken und uns ins Gefängnis zu bringen.“
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Die Weltreporter im Gespräch – Ab sofort lassen wir Sie noch näher ran, an unsere Arbeit in aller Welt: Im WR-Podcast erzählen künftig alle drei Monate Korrespondenten von Jobs und Recherchen zwischen Durban und Dänemark, geben einen Einblick in den Korrespondentenalltag, live & lebendig. Wir schalten unsere Mikrophone für Sie auf Empfang und laden ein in unsere Schreib- und Tonbüros auf fünf Kontinenten. Der erste WR-Podcast führt hinter die Kulissen des größten Korrespondenten-Netzwerks freier Auslandsjournalisten, das über 47 deutschsprachige Reporter in fast ebenso vielen Ländern vereint.

Kerstin Zilm im per Wolldecke isolierten Studio.
Wer sind die Weltreporter-Journalisten und was bewegt sie? Erfahren Sie, unter welchen Bedingungen Geschichten entstehen, die Sie später gut gemischt online oder im deutschen Radio hören. Verbringen Sie 20 Minuten mit uns – jenseits der Schlagzeilen. In diesem ersten Podcast treffen Sie einen Weltreporter-Gründer, hören, welches amerikanische Geräusch unsere Kollegin in Los Angeles zuweilen von der Arbeit abhält und was Kollegen in Krisenregionen auch in schwierigen Zeiten zum Durchhalten motiviert.
Ganz nebenbei bekommen Sie Antworten auf eine Reihe von Fragen, die Sie sich vielleicht noch nie so gestellt haben 😉 Zum Beispiel:

Ägypten-Korrespondent Jürgen Stryjak während des Volksaufstandes 2011 auf dem Tahrir-Platz.
Der erste Weltreporter Podcast widmet sich aber auch ernsteren Themen: Im Interview berichtet Jürgen Stryjak, der seit 17 Jahren in Kairo arbeitet, vom Arbeit und Leben in einem Land, in dem Anschläge und Unterdrückung zum Alltag gehören. Er schildert, welche Spuren es hinterlässt, wenn man tagein tagaus über Menschen berichtet, die Gewalt oder Terror erleben, die desillusioniert oder hoffnungslos sind. Jürgen Stryjak erzählt auch, was ihn motiviert, sich von schwierigen Situationen nicht unterkriegen zu lassen. Er erzählt von einer Begegnung mit Amir Eid und seiner Indie-Band Cairokee, die er bei Proben in Kairo traf. Auch sie lassen sich nicht einschüchtern. Eines ihrer jüngeren Lieder heisst Akhr Oghniyya – zu deutsch: »Das letzte Lied«. Selbst wenn dies mein letztes Lied wäre, singt Amir Eid im Refrain, selbst dann würde ich noch von der Freiheit singen.

Janis Vougioukas nach der WR-Gründung im Jahr 2007 während einer Recherche über Folgen der Umweltverschmutzung in China.
Außerdem lernen Sie Janis Vougioukas kennen. Janis ist heute Stern-Reporter in Shanghai. Er war es, der im Jahr 2000 mit einer Handvoll anderer Journalistenschüler die Idee hatte, das Weltreporter-Netzwerk zu gründen. Im Gespräch erinnert sich Janis daran, wie damals auch die Einsamkeit als Freischaffender mit ein Motiv dafür war, das Abenteuer Weltreporter zu wagen. “Wir waren überrascht, wie viel man über Internet-Abstimmungen und Skype effizient, global und günstig organisieren konnte”, erzählt Janis Vouigoukas als ihn Kerstin Zilm über diverse Zeitzonen hinweg während einer Recherche in Hongkong erreicht. Damals begann die Medienkrise, und er und die 20 ersten Weltreporter waren begeistert, wie rasch sich die Existenz des weltweiten Reporternetzwerks in den Redaktionen herumsprach: “Es war toll zu sehen, wie dankbar die Redaktionen, die nicht mehr selbst schnell jemanden losschicken konnten oder wollten, unser Angebot angenommen haben.” Heute gehören zum Netzwerk 47 freie Korrespondenten in aller Welt und 27 Kollegen, die inzwischen nicht mehr als freie Journalisten arbeiten oder wieder von Deutschland aus berichten.

Leonie March interviewt einen Fährtenleser.
Zusammengestellt haben diese “20 Minuten Weltreporter persönlich” unser Podcast-Team in drei Kontinenten und diversen Zeitzonen. An Mikro und Mischpult agierten Kerstin Zilm in Los Angeles, Leonie March in Durban und Sascha Zastiral in London.
Viel Spaß beim Zuhören, und bis zum nächsten Podcast – in spätestens drei Monaten.

Im Helikopter über Durban

Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Der 3. Mai ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Um die allerdings ist es nicht sonderlich gut bestellt. Der Verband Reporter ohne Grenzen (ROG) hat zu diesem Termin eine überraschende und teils erschreckende Rangliste mit vielen Hintergründen zur Pressefreiheit in der Welt zusammengestellt.
 Es ist ein hochspannendes und informatives Dokument, viel mehr als eine Liste.
Es ist ein hochspannendes und informatives Dokument, viel mehr als eine Liste.
Ein Blick auf die interaktive Weltkarte der ROG-Kollegen ist extrem aufschlussreich. Denn in der Übersicht geht es nicht nur darum, wo Journalisten, die ihre Arbeit erledigen wollen, dabei behindert oder sogar festgenommen werden.
Es werden auch Manipulationen und Monopole angesprochen – und keineswegs nur Einschränkungen in Diktaturen.
„Besonders erschreckend ist, dass auch Demokratien immer stärker unabhängige Medien und Journalisten einschränken, anstatt die Pressefreiheit als Grundwert hochzuhalten“, sagt ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske zu dem Ranking, für das vor allem Ereignisse und Daten aus 2016 zusammengetragen wurden.
Zur Verschlechterung der Lage für Journalisten tragen weltweit auch medienfeindliche Rhetorik, beschränkende Gesetze und politische Einflussnahme bei. Deutschland hält sich auf der Liste unverändert auf Platz 16. Australien steckt zwischen Surinam und Portugal auf Platz 19. Nicht zuletzt weil in meinem Berichtsgebiet Journalisten beispielsweise nicht unbehindert über die Flüchtlingspolitik berichten dürfen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Vorvergangenen Freitag, 7. April 2017, wurde ein Anschlag in der Stockholmer Innenstadt verübt. Ähnlich wie in Berlin raste ein LKW durch die Fußgängerzone und der Fahrer ermordete so vier Menschen. Vier Menschen, die ihren Angehörigen entrissen wurden und deren Leben durch Terror gewaltsam beendet wurde. Eine schreckliche Tat, die dazu geführt hat, dass viele Schweden öffentlich ihr Mitgefühl ausgedrückt sowie der Polizei gedankt haben.
Über die Hintergründe des mutmaßlichen islamistischen Terroristen habe ich unter anderem für Zeit online (hier über die schwedischen Reaktionen und hier unmittelbar nach der Tat) berichtet und auch einen Kommentar für die Deutsche Welle geschrieben. Auf Artikel und Kommentar wurde wiederum mit einigen Leserkommentaren geantwortet. Die Debatten, die das Internet ermöglicht, sind eine hervorragende Möglichkeit, das Meinungsmonopol (wenn man es denn so nennen möchte) der Journalisten zu brechen.
Ziemlich häufig jedoch, geht es längst nicht um Debatten, sondern was in den Kommentarspalten zu lesen sind, sind Pauschalverurteilungen und Wutausbrüche. Als Antwort auf einige Kommentare unter meinem Kommentar für die Deutsche Welle habe ich selber eine Antwort verfasst. Denn Debatten sind es, die nötig sind, und nicht Pauschalvorwürfe. Hier also meine Antwort (die bei DW nicht mehr veröffentlicht werden konnte, da die Kommentarfunktion nur kurzzeitig offen ist):
“Vielen Dank für die zum großen Teil kritischen Kommentare, auf die ich gerne kurz antworten möchte. Die Angehörigen der Opfer dieser grausamen Tat verdienen unser aller Mitgefühl und denen, die in Stockholm getötet worden sind, gilt es zu gedenken. Das ist bei einer solchen Tat eine Selbstverständlichkeit und anders als manch Kommentator schreibt, meine ich nicht, dass „die Opfer und ihre Familien schnell vergessen werden müssen“. Derartiges steht in meinem Kommentar nicht. Das wird jedem, der diesen wirklich gelesen hat, klar sein.
Was ich in meinem Kommentar hingegen tue, ist auf die gesellschaftlichen Folgen einer derartigen Terrortat zu fokussieren. Das heißt ganz und gar nicht, die schrecklichen Folgen für die Familien in Abrede zu stellen. Dass manch ein Leser es so gelesen hat, gibt mir zu denken, manchmal kommt man nich umhin zu erwägen, ob es Leser gibt, die aus einem Text nur das herauslesen, dass sie lesen möchten. Für eine Familie ist es grausam, einen Angehörigen durch eine derartige Terrortat zu verlieren, diesen gilt unser Mitgefühl.
Im Text erwähne ich auch andere Taten und Unfälle, die in Teilen dem aktuellen Attentat ähneln. Immer wieder wird einem bei Vergleichen der Vorwurf gemacht, gleichzusetzen. Doch vergleichen und gleichsetzen sind verschiedene Dinge. Von daher wird in diesem Text Terror nicht mit einem Unfall gleichgesetzt. Verglichen werden kann, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Das mag manchmal schwieriger sein als einfach gleichzusetzen, doch es sind die differenzierten Betrachtungen, die Diskussionen ermöglichen, die Politik und Gesellschaft weiterbringen können. Wer die Terrorgefahr überhöht und andere Risiken verdrängt (so sind alleine im Januar auf Deutschlands Straßen 234 Menschen ums Leben gekommen – Tendenz glücklicherweise fallend), hat einen großen Wunsch der Terroristen womöglich schon erfüllt: panisch und irrational zu reagieren.
Zuletzt noch kurz zum Zitat des israelischen Historikers Yuval Noah Harari. Es handelt sich selbstverständlich um eine Art bildhaften Vergleich. Ihm geht es explizit darum, was derartiger Terror (die Fliege) mit Europa (der Porzellanladen) macht. Auch Harari spricht also von gesellschaftlichen Auswirkungen und nur weil er die schrecklichen Folgen für die einzelnen Familien nicht erwähnt, negiert er diese noch lange nicht. Es geht auch ihm um eine Betrachtung der möglichen gesellschaftlichen Bedrohung. Das gesamte Interview mit ihm ist im Spiegel 12/2017 erschienen und auch online zu lesen (derzeit jedoch nur gegen Bezahlung). Dass Terrorismus (die Fliege) bekämpft werden sollte, dafür würde sich sicherlich auch Harari aussprechen.
Dass Terror durch geschlossene Grenzen nicht verhindert wird, zeigen Beispiele der letzten Jahrzehnte wie NSU und RAF. Und: Nein, andere (rechts- wie linksxtremistische) Terrortaten zu erwähnen, ist weder Gleichsetzung noch Verharmlosung islamistischen Terrors, sondern lediglich ein differenzierter Beitrag zur Debatte.”
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Nur noch ein paar Stunden, dann wissen wir vermutlich, wer demnächst die USA regiert. Kalifornien entscheidet auch noch über 17 Themen per Volksabstimmung. Ich kann nach monatelanger Dauerbeschallung zum Thema Wahl keine Nachrichten mehr hören und schalte morgens erstmal weder Fernsehen noch Radio ein – seit einer Woche. Mein Stück dazu für den Deutschlandfunk.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

 Recherchen zu unserem neuen Buch “Die Flüchtlingsrevolution” führten uns in südafrikanische Frisörsalons und kenianische Lager, in neuseländische Küchen und bosnische Wohnzimmer. Im ersten Weltreporter Spezial (zu hören via SoundCloud) erzählen wir, wie dieses Buch entstand und lassen einige Interviewpartner zu Wort kommen.
Recherchen zu unserem neuen Buch “Die Flüchtlingsrevolution” führten uns in südafrikanische Frisörsalons und kenianische Lager, in neuseländische Küchen und bosnische Wohnzimmer. Im ersten Weltreporter Spezial (zu hören via SoundCloud) erzählen wir, wie dieses Buch entstand und lassen einige Interviewpartner zu Wort kommen.
65 Millionen Menschen leben derzeit nicht in ihrer Heimat sondern sind unterwegs: zu Fuß und per Boot, per Bus und in Fliegern, auf Transitrouten, in Lagern, in provisorischen Unterkünften. Sie halten sich an Orten auf, die vielleicht eines Tages eine neue Heimat werden, oder vielleicht auch nicht. Sie fliehen vor Naturkatastrophen oder Armut, vor Gewalt oder Verfolgung, vor Unrecht oder Krieg.

Lidia Nunez und Anwältin Yanci Montes
Über einige Dutzend dieser Menschen schreiben wir in unserem Buch “Die Flüchtlingsrevolution”, und einige von ihnen lernen Sie im neuen, 20-minütigen Audio Weltreporter Special kennen.
Wer sind diese Menschen? Welche Lebensgeschichten verbergen sich hinter der schwer vorstellbaren Zahl 65 000 000?
Wir sprechen mit einer Frau, die aus Beirut nach Frankreich floh, mit einer Kongolesin, die in Südafrika landete, doch auch dort nicht sicher ist, mit Fischern in Lesbos und Landmigranten in chinesischen Metropolen.

Coco Bishogo Ruvinga, die vom Kongo nach Südafrika geflüchtet war, wurde in ihrem Friseursalon Opfer fremdenfeindlicher Gewalt
Wir analysieren in unserem Buch Fakten und versuchen Hintergründe zu erklären, beschäftigen uns mit historischen Aspekten und erörtern, wie Politiker in verschiedenen Regionen auf diese Völkerwanderung reagieren. Um die enormen Dimensionen begreifbar zu machen, erzählen wir jedoch vor allem von persönlichen Schicksalen – Ein Versuch, dieser Revolution, die unsere Welt bewegt, Gesichter und Stimmen zu geben.

Kerstin Zilm und Lidia Nunez vor dem Gerichtsgebäude
Im WR Spezial erfahren Sie auch: Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden? Wie ist uns gelungen, mit 26 Kollegen aus fünf Kontinenten und doppelt so vielen Zeitzonen ein Konzept zu erarbeiten, das mehr ist als eine Sammlung von Geschichten: Ein ausgewähltes Portfolio individueller Texte, die zusammen ein höchst komplexes Bild ergeben; denn Flucht hat heute enorm viele Facetten.
Erleben Sie, wie das kenianische Dadaab klingt, was wir im Goethe-Institut in Yogjakarta erfahren haben und was wir auf dem Balkan, in Malaysia und Magdeburg aufnehmen konnten.
Zusammengestellt haben das Audio Spezial Kerstin Zilm in LA, Leonie March in Durban, Randi Häusler in Stockholm und Sascha Zastiral. Sascha Zastiral, der viele Jahre Weltreporter in Bangkok war und seit kurzem in London arbeitet, hat auch die Musik für diese Weltreporter Audio Reportage komponiert und aufgenommen. Dieser Link führt zur SoundCloud, auf der Sie das Spezial anhören können.
Töne, Berichte und Interview für den 20-minütigen Report lieferten außerdem Bettina Rühl (Nairobi), Birgit Kaspar (Toulouse), Christina Schott (Jakarta), Alkyone Karamanolis (Athen), Marc Engelhardt (Genf), Danja Antonovic (Belgrad).
 Wenn Sie das Audio-Spezial neugierig gemacht hat:
Wenn Sie das Audio-Spezial neugierig gemacht hat:
Unser neues Buch “Die Flüchtlingsrevolution”, ein 350-seitiges Gemeinschaftswerk von 26 Weltreportern ist Ende August im Pantheon Verlag erschienen und sowohl als ebook wie broschiert (16,99 €) erhältlich.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

 Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.
Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile in Kalifornien, angekommen 2003 als ARD-Radio-Korrespondentin und inzwischen als selbständige rasende Reporterin unterwegs mit allen Höhen und Tiefen, die das freischaffende Leben so mit sich bringt.
Zu den Höhen zählt eindeutig, dass es nun das erste Buch von mir gibt. Ein Jahr in Kalifornien!
Als der Herder-Verlag mich fragte, ob ich Lust auf das Projekt hatte, war ich sofort neugierig. Schon lange träumte ich davon, ein Buch zu schreiben. In der Grundschule habe ich das sogar schon mal gemacht. Selbst gebundene und illustrierte Abenteuer eines Mädchens, frei erfunden mit starken autobiographischen Zügen. Der Dackel meiner Freundin hat das Werk leider vernichtet bevor es zum Bestseller werden konnte.
Jetzt also ein neuer Versuch. “Ich finde das Jahr, in dem ich mich selbständig gemacht habe spannender als mein erstes Jahr in Kalifornien”, sagte ich beim Treffen mit dem Lektor. Der antwortete diplomatisch, das sei sicher auch sehr interessant, aber in der Serie gehe es mehr darum, wie das so ist, wenn man in einem neuen Land ankommt. “Die Bürokratie ist überwältigend, die Menschen sind fremd und das Wetter ganz anders.”
Ja, wie war das damals eigentlich? Ich versuchte mich zu erinnern und mir fiel einiges ein: wie meine Ikea-Möbel in Bubble-Wrap ewig auf einem Containerschiff durch den Panama-Kanal schipperten und ich deshalb auf der Luftmatratze schlief. Wie am roten Teppich die Prominenz einfach an mir vorbei ging, weil die internationale Radiojournaille in Hollywood nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Wie ich wegen zu großer Vorsicht durch die erste Führerscheinprüfung gefallen bin. Wie ich den ersten prall gefüllten Waffenschrank gesehen habe. Wie ich Wasserkanister in die Grenzwüste geschleppt habe. Wie ich staunend in der Gischt der Wasserfälle vom Yosemite-Nationalpark stand. Und natürlich wie wunderbar es nach 14 Jahren Berliner Winter war, dass so oft die Sonne scheint. Das ist übrigens immer noch wunderbar!
Jetzt ist es raus in der Welt, mein erstes Buch. Bei mir ist allerdings noch keins angekommen, obwohl der Verlag das Paket mit Belegexemplaren schon vor einer Weile abgeschickt hat. Auch das ist so eine kalifornische Erfahrung: transatlantische Post kostet zwar ein Vermögen, bewegt sich aber im Tempo der Postkutschen-Zeit.
Ob das ins nächste Buch passt? Eher nicht. Das wird eine erfundene Geschichte mit nur ein paar autobiographischen Zügen.
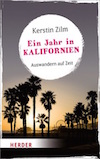
bestellen beim lokalen Buchhändler oder amazon
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Das Programm des Weltreporter-Forums 2016 in Raiding/Burgenland steht:
Wir freuen uns mit unseren internationalen Gästen auf einen spannenden Sommer-Nachmittag auf dem Land. Und auf Sie!
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Noch nie schien die Welt so instabil und aus den Fugen geraten wie jetzt – zumindest aus europäischer Sicht. Globalisierung, Terror, Kriege und blutige Konflikte. Migranten, Flüchtlinge und Finanzströme: Die Ratlosigkeit ist bei Wählern wie Politikern gleichermaßen groß.
Transparenz herzustellen und Zusammenhänge aufzuweisen gehört zu den Hauptaufgaben von Journalisten im Allgemeinen und Auslandskorrespondenten im Besonderen. Denn sie sind die Experten vor Ort, sie erleben die Wirklichkeit jenseits der Grenzen hautnah. Lösen lassen sich die Probleme der Welt an einem Nachmittag nicht. Aber gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen werfen, das können wir:
Beim WELTREPORTER-FORUM am 23. Juli berichten die Weltreporter und ihre Gäste von dem, was in ihren Welten gerade in Bewegung ist.
WELTREPORTER-FORUM
»Welt in Bewegung«
Keynotes, Kurzvorträge im Pecha-Kucha-Format + eine Podiumsdiskussion
mit Alexandra Föderl-Schmid (Chefredakteurin Der Standard), Karim El Gawhary (Weltreporter + ORF-Korrespondent), Hasnain Kazim (Spiegel), Florian Klenk (Chefredakteur Falter), Wieland Schneider (stellv. Auslandschef Die Presse), Cornelia Vospernik (Moderatorin ORF), Autor & Bruno-Kreisky-Preisträger Najem Wali & Weltreportern von allen Kontinenten
Samstag, 23. Juli 2016
14:00 – 18.30 Uhr
Franz Liszt-Konzerthaus
A-7321 Raiding
Eintritt frei
ANFAHRT:
Für Interessenten steht ein Bus-Service von Wien nach Raiding zur Verfügung:
Abfahrt Wien am Karlsplatz am 23. Juli ist um 12:00 hinter dem Musikverein, Bösendorferstr. 12
Abfahrt Raiding zurück nach Wien um 20:00.
Kosten: 12 Euro
Anmeldung unter raiding@weltreporter.net
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Wenn es irgendjemanden gibt, der über Donald Trump’s Aufstieg feixt, dann ist es Chinas offizielle Presse. Zeigen die Exzesse der Kampagne des Milliardärs doch aus den Augen Pekings die Schwächen der Demokratie. Das Parteiorgan China Daily zeigt Trump (hier) als Baby, das der Freiheitsstatue aus dem Kinderwagen ins Gesicht spuckt. Solche Irren hätten in unserem sozialistischen System gar keine Chance, ist der Tenor der Kommentare. Während ja Adolf Hitler und Benito Mussolini damals durch Wahlen an die Macht gekommen seien. Trump, ein “narzisstischer und aufhetzender” Kandidat habe in den USA eine Büchse der Pandora geöffnet, schreibt etwa die als nationalistisch bekannte Global Times nach den Ausschreitungen bei der Trump-Kampagne in Chicago (hier). Er habe die Weißen der ehemaligen Mittelschicht angesprochen, denen es seit der Wirtschaftskrise ab 2008 immer schlechter gehe. “Großmäulig, antitraditionell und das Prinzip der Offenheit missbrauchend, ist er der perfekte Populist, der mit Leichtigkeit die Öffentlichkeit provozieren kann. Trotz der Versprechen der Kandidaten wissen die Amerikaner, dass Wahlen ihr Leben nicht wirklich verändern. Warum also nicht Trump unterstützen und Dampf ablassen?”, schreibt das Blatt. Dass Wahlen das Leben der Menschen nicht verändern, ist das Kernargument. Wenn das so ist, dann doch lieber gar keine Wahlen, so wie in China. Denn hier haben Populisten keine Chance. Der Kommentar endet mit der Warnung: “Die USA sollten auf sich selbst aufpassen, dass sie nicht zu einer Quelle destruktiver Kräfte gegen den Weltfrieden werden – anstatt immer mit den Fingern auf andere Länder zu zeigen wegen deren angeblichen Nationalismus und Tyrannei.” Letzteres ist übliches Parteizeitungs-Sprech. Ersteres verrät eine gewisse Genugtuung – teilt China damit doch Sorgen anderer Länder, auch der westlichen demokratischen Welt. Welcher Europäer würde Donald Trump schon gern im Weißen Haus sehen? Wohl eher wenige. Doch aus anderen Gründen.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Tim Kukral, derzeit Volontär beim NDR und vorher Student in Hamburg, hat eine Arbeit über freie Auslandskorrespondenten geschrieben. Grundlage des Werks, das jetzt beim Herbert von Halem Verlag erschienen ist waren Interviews mit 14 Weltreportern.

Aus dem Blurb: ‘Durch eine qualitative Befragung von Mitgliedern des renommierten Journalistennetzwerks Weltreporter liefert dieser Band erstmals umfangreiche Erkenntnisse über die Arbeit der freien Auslandskorrespondenten.’
Kukrals Buch ‘Arbeitsbedingungen freier Auslandskorrespondenten’ ist Band 8 der Reihe “Journalismus International” und auch online bestellbar.
Zu Kukrals Fragen gehörten: Im Vergleich zu ihren festangestellten Kollegen haben die „Freien“ eher den Blick und die Zeit für Geschichten, die abseits liegen von den starren Themenplänen der Redaktionen in der Heimat. Aber (wie) kann man davon leben? Wie sieht der Alltag der freien Korrespondenten aus? Und wie sind sie überhaupt zu diesem Beruf gekommen?
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Spanien kommt aus der Bluthochdruckzone gar nicht mehr raus. Ein Skandal jagt den anderen, Oberthema: Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Klingt schrecklich langweilig, ist aber ein echter Aufreger, zumindest wenn die Protagonisten ein Stierkämpfer und eine Podemos-Abgeordnete sind.
Fran Rivera, genannt Paquirri, hat ein Foto von sich und seiner jüngsten Tochter gepostet. Es zeigt ihn beim Training, in der heimischen Arena, mit einer Jungkuh, und zwar in dieser Pose:

Musische Früherziehung, Unterrichtseinheit Tradition
Daneben der Text: “Carmens Debüt – Sie gehört zur fünften Generation einer Stierkämpferfamilie. Mein Großvater zeigte das gleiche meinem Vater, mein Vater mir, ich meinen beiden Töchtern…”
Innerhalb weniger Stunden war die Debattennation zweigeteilt, in den Talkshows liefen die Mikrofone heiß, Verfechter (“Tradition”, “Weitergabe von Werten”) und Gegner (“Angeber”, “unverantwortlich”, “Tierquälerei”) warfen sich alle Nettigkeiten zwischen “Banause” und “Mörder” an den Kopf. Und natürlich wurde sogleich die Parallele zu diesem Skandal gezogen:

Politische Früherziehung, Unterrichtseinheit Eltern-Kind-Rechte
Podemos-Abgeordnete Carolina Bescansa hatte doch tatsächlich zur ersten Parlamentssitzung ihr Baby mitgebracht. Die Vize-Parlamentspräsidentin höchstpersönlich wies die Neue darauf hin, dass es auch eine KiTa im Parlament gäbe und ließ sich dann lang und breit in einer Talkshow darüber aus, ob ein “geschlossener Raum mit 400 Erwachsenen” tatsächlich das richtige Ambiente für einen Säugling wäre. Auch da verliefen tiefe Fronten zwischen Befürwortern (“Biologie, Mutter-Kind-Bindung”, “Zeichen setzen für arbeitende Eltern”) und Gegnern (“Populismus”, “unverantwortlich”). Man könnte jetzt lang und breit tatsächliche und mutmaßliche Gesundheitsrisiken für die jeweiligen Säuglinge in Plenarsaal/Arena analysieren, über die Ähnlichkeiten und Unterschiede beider Manegen sinnieren; interessant bei der Debatte ist vor allem, dass diejenigen, die sich über Bescansas Baby echauffierten Paquirris Baby beklatschen. Und umgekehrt natürlich. Die Argumente sind austauschbar, denn im Kern geht es nicht um die Kinder, Mütter, Väter, sondern um Politik: um die ungezogenen Neuen (Podemos und Co) gegen die überkommenen Alten (Toreros und Co).
Das zeigte sich auch am anderen großen Aufreger der letzten Wochen, Oberthema: angemessene Bekleidung/Haartracht. Die Vizepräsidentin des Parlaments kommentierte die Rasta-Locken eines Podemos-Abgeordneten mit einem “So lange da keine Läuse überspringen, ist mir das egal”, Podemos-Chef Pablo Iglesias revanchierte sich dafür, in dem er auf einer Pressekonferenz eine Journalistin für ihren “prächtigen Pelzmantel” lobte – das ist stilistisch eleganter, in der Sache aber genauso dämlich.
Es wird jedenfalls höchste Zeit, dass die Legislatur ins Rollen kommt und so vielleicht, vielleicht, ein bisschen mehr Inhalt in die Scheindebatten rutscht.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

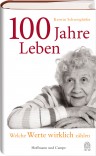 “100 Jahre Leben – welche Werte wirklich zählen” heisst mein neues Buch, das soeben bei Hoffmann und Campe erschienen ist: In berührenden Gesprächen und Begegnungen mit zehn Hundertjährigen habe ich manch ein Geheimnis erfahren und oft verblüffende Antworten auf entscheidende Lebensfragen erhalten: Was macht eine gute Freundschaft, Beziehung oder Ehe aus? Wie kann die grosse Liebe zur Liebe des Lebens werden? Wie soll man umgehen mit Schmerz und Verlust? Von der Bäuerin bis zur Künstlerin, vom Priester bis zur Geschäftsfrau , von Cannes über München, Jena oder Dortmund bis London – in zehn bewegenden Lebensgeschichten spiegeln sich die grossen Themen des Menschseins.
“100 Jahre Leben – welche Werte wirklich zählen” heisst mein neues Buch, das soeben bei Hoffmann und Campe erschienen ist: In berührenden Gesprächen und Begegnungen mit zehn Hundertjährigen habe ich manch ein Geheimnis erfahren und oft verblüffende Antworten auf entscheidende Lebensfragen erhalten: Was macht eine gute Freundschaft, Beziehung oder Ehe aus? Wie kann die grosse Liebe zur Liebe des Lebens werden? Wie soll man umgehen mit Schmerz und Verlust? Von der Bäuerin bis zur Künstlerin, vom Priester bis zur Geschäftsfrau , von Cannes über München, Jena oder Dortmund bis London – in zehn bewegenden Lebensgeschichten spiegeln sich die grossen Themen des Menschseins.
100 JAHRE LEBEN
Welche Werte wirklich zählen
Was uns die Weisheit hundertjähriger Menschen über das Leben, das Glück und die Liebe lehrt
Hoffmann und Campe ISBN: 978-3-455-50375-3
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

 Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm wahrscheinlich. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independència“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm wahrscheinlich. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independència“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.
Was der Wirtschaftsprofessor da sagte, bestätigte, was viele langjährige Korrespondenten vermuten: dass es innerhalb der heterogenen Junts pel Sí-Liste Differenzen über Weg und Ziel gibt, dass der Minimalkonsens nicht Unabhängigkeit um jeden Preis, sondern Verhandlungen mit Madrid und Brüssel sind. Vom Gezerre um Freigabe des Gesamtinterviews (einen Tweet hatte ich unmittelbar nach Interview abgesetzt), vom Druck und den widersprüchlichen Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen, von der Unterstützung durch die Kollegen vor Ort und vom Círculo de corresponsales, erzähle ich gern mal an anderer Stelle. Samstag Nachmittag packte ich jedenfalls einen Ausschnitt aus dem Interview auf Soundcloud, die Online-Zeitung Eldiario.es brachte die Geschichte, El País, La Vanguardia, Antena 3 und ein halbes Dutzend anderer Medien nahmen das Thema auf, die beiden Unabhängigkeitslisten veröffentlichten Kommuniqués. Natürlich schmeicheln solche 15 Minuten Ruhm dem journalistischen Ego, wesentlicher ist für mich eine andere Erkenntnis: Freie Korrespondenten haben einen Standortvorteil. Wir sind meist lange genug in einem Land, um auch die Zwischentöne einer Debatte zu verstehen. Botschaften und Sender wechseln ihre Mitarbeiter gerne aus, um einen “frischen Blick von außen” zu garantieren oder – weniger nett gesagt – “Verbuschung” zu vermeiden. Aber genau diese Expertise ist unser großes Kapital. Und unverzichtbar, wenn es um Analyse, Interpretation, um Hintergrund geht. Das hoffe ich zumindest.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schon längst über die zum Quasi-Referendum erklärten, katalanischen Wahlen geschrieben haben, aber ich kam bisher nicht dazu, weil ich mit den Nachwehen eines zum Politikum gewordenen Interviews beschäftigt war. Ein ARD-Kollege und ich haben uns am Freitag vor der Wahl mit Oriol Amat, Wirtschaftsprofessor und Nummer 7 der separatistischen Junts pel Si-Liste getroffen. Ursprünglich sollte es um mögliche wirtschaftliche Konsequenzen einer Sezession gehen, das Interview mit dem Experten der Gegenseite war bereits geführt. Aber schon bald sprachen wir von möglichen Szenarien nach einem Regierungswechsel in Spanien. Als ein sehr wahrscheinliches Szenario schien Amat ein Madrider Angebot zu Verhandlungen um ein neues Autonomiestatut. Dass eine solche Offerte von den Katalanen angenommen würde, schien ihm nicht ausgeschlossen. Ich war überrascht: Seit Jahren demonstrieren regelmäßig Hunderttausende für einen „eigenen Staat“, die „In-, Inde-, Independencia“-Rufe sind fester Bestandteil der politischen Folklore und in jedem zweiten Interview beschwören Politiker, „es gebe keinen Weg zurück“. Zwei Tage vor der „plebiszitären“ Wahl ein Autonomiestatut als mögliche Lösung zu präsentieren, ist etwa so, als lasse man Sprinter monatelang im Hochland für Olympia trainieren, nur um sie dann zur Bushaltestelle joggen zu lassen. Ich fragte nach. Amat blieb dabei.
Was der Wirtschaftsprofessor da sagte, bestätigte, was viele langjährige Korrespondenten vermuten: dass es innerhalb der heterogenen Junts pel Si-Liste Differenzen über Weg und Ziel gibt, dass der Minimalkonsens nicht Unabhängigkeit um jeden Preis, sondern Verhandlungen mit Madrid und Brüssel sind. Vom Gezerre um Freigabe des Gesamtinterviews (einen Tweet hatte ich unmittelbar nach Interview abgesetzt), vom Druck und den widersprüchlichen Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gingen, von der Unterstützung durch die Kollegen vor Ort und vom Círculo de Corresponsales, erzähle ich gern mal an anderer Stelle. Samstag Nachmittag packte ich jedenfalls einen Ausschnitt aus dem Interview auf Soundcloud, die Online-Zeitung Eldiario.es brachte die Geschichte, El País, La Vanguardia, Antena 3 und ein halbes Dutzend anderer Medien nahmen das Thema auf, die beiden Unabhängigkeitslisten veröffentlichten Kommuniqués. Natürlich schmeicheln solche 15 Minuten Ruhm dem journalistischen Ego, wesentlicher ist für mich eine andere Erkenntnis: Freie Korrespondenten haben einen Standortvorteil. Wir sind meist lange genug in einem Land, um auch die Zwischentöne einer Debatte zu verstehen. Botschaften und Sender wechseln ihre Mitarbeiter gerne aus, um einen “frischen Blick von außen” zu garantieren oder – weniger nett gesagt – “Verbuschung” zu vermeiden. Aber genau diese Expertise ist unser großes Kapital. Und unverzichtbar, wenn es um Analyse, Interpretation, um Hintergrund geht. Das hoffe ich zumindest.
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Skandinavien-Korrespondent Clemens Bomsdorf vertritt auf der netzwerk recherche Jahreskonferenz in Hamburg (3./4. Juli) am Samstag die Weltreporter. Mit Daniel Jahn (Chefredakteur AFP) und Sonja Volkmann-Schluck (Redakteurin n-ost) diskutiert Weltreporter Bomsdorf am 4.7. ab 10.30 Uhr über Auslandsjournalismus:
 “Auslandsreporter unter Druck – Wie berichten über Krisen und Kriege wenn an der Ausstattung gespart wird?” Moderiert wird die Veranstaltung beim NDR Fernsehen in Hamburg von der freien Journalistin Gemma Pörzgen.
“Auslandsreporter unter Druck – Wie berichten über Krisen und Kriege wenn an der Ausstattung gespart wird?” Moderiert wird die Veranstaltung beim NDR Fernsehen in Hamburg von der freien Journalistin Gemma Pörzgen.
Die These: Gerade im Ausland machen viele Journalisten die Erfahrung, dass ihre Medien sich zwar gerne mit guten Geschichten aus aller Welt schmücken, aber immer seltener für entstehende Kosten aufkommen. Honorare sinken und Reisekosten werden selten übernommen. Besonders gravierend ist das, wenn in Krisengebieten an Versicherungsschutz, Sicherheitswesten und moderner Ausrüstung gespart wird. In den Redaktionen fehlt es häufig an Ansprechpartnern unter den Redakteuren, die aus eigener Erfahrung wissen, wie es ist, im Ausland zu arbeiten. Haben fundierte Berichterstattung, eigene Recherche und Qualität dennoch eine Zukunft?
Wir berichten aus mehr als 160 Ländern –
aktuell, kontinuierlich und mit fundiertem Hintergrundwissen.

Erst piepste das Telefon – eine neue Textnachricht. Die hab ich nicht beachtet. Schließlich war ich gerade am Kochen! Dann wurde ich aber doch neugierig, schaute nach und legte zwischen Pfannen und Töpfen einen kleinen Freudentanz auf die Küchenfliesen!
“Du hast einen Preis bei den Southern California Journalism Awards gewonnen!” schrieb ein Kollege. “Deine Geschichte “I knew you back then” für KCRW”.
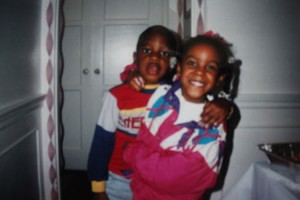
KCRW?! Super cool! Erstens ist das mein Lieblingssender in den USA. Zweitens war es spannend, die Geschichte von Skylar und Randall aus South LA aufzunehmen und weiterzuerzählen. Drittens bin ich dann doch ein wenig stolz, dass ich einen Preis für eine Geschichte auf Englisch gewinne in einem Feld von vielen etablierten US-Journalisten und Journalistinnen.
Leider, leider, leider konnte ich bei der Preisverleihung nicht dabei sein, habe aber inzwischen Online nachgeschaut, ob es auch wirklich stimmt und auch die Begründung für die Preisvergabe gelesen:
“How can a piece sound as if it wasn’t edited as if it wasn’t even recorded. This is powerful and real and we learn about two people who were friends as kids but then they turned out very differently. We discover the differences as they do – and Skylar gives us insight into her friend, Randall almost as an aside. We are there!”
Grobe Übersetzung: “Wie kann sich ein Stück anhören, als wäre es gar nicht bearbeitet, nicht mal wirklich aufgenommen. Das ist stark und echt und wir erfahren etwas über zwei Menschen, die als Kinder Freunde waren, dann aber sehr unterschiedliche Wege gingen. Wir entdecken mit ihnen ihre Unterschiede und Skylar hilft uns fast nebenbei, ihren Freund Randall zu verstehen. Wir sind mittendrin!”
Ich krieg jetzt noch rote Wangen und heiße Ohren wenn ich das lese!
Beim Nachschauen, ob ich wirklich gewonnen habe und warum entdeckte ich dann: ich hab noch einen Preis gewonnen! Diesmal in der internationalen Kategorie. Darin sind alle Geschichten aufgenommen, die wir Reporterinnen und Reporter aus aller Welt in Süd Kalifornien für Medien zu Hause produzieren.
Auch hier gewann eine Geschichte von mir aus South Los Angeles.
Diesmal ging es um die tödlichen Schüsse von Polizisten auf den unbewaffneten Ezell Ford. Ich war bei einer anschließenden Gemeindeversammlung mit Polizisten in einer Kirche gewesen und hatte darüber für das Deutschlandradio berichtet.
Und die Jury schreibt zur Begründung:
“Conveys the deep pain, mistrust and anger of many in the African-American community when it comes to dealing with the LAPD. You can practically feel the anger and a certain level of helplessness bubbling just beneath the surface of everyone involved.”
Übersetzt in etwa: “Vermittelt tiefgehenden Schmerz, Misstrauen und Wut, die viele in der Afroamerikanischen Gemeinde spüren wenn sie mit der Polizei von Los Angeles zu tun haben. Man kann die Wut praktisch spüren und auch ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit unter der Oberfläche bei allen, die an den Geschehnissen beteiligt sind.”
So ein Preis tut doch tatsächlich gut. Mehr als ich gedacht hatte. Vermutlich auch, weil wir Radiomenschen ja doch meist allein unterwegs sind mit Mikrofon und Aufnahmegerät, wenig feed back bekommen und oft das Gefühl haben, Beiträge ‘versenden’ sich vor allem.
Ja, und so freue ich mich Stunden später noch immer über diese Anerkennung, bin froh, dass es in Deutschland und den USA Medien gibt, die an den Geschichten, die ich abseits ausgetretener Pfade finde, interessiert sind und dass ich sie hier in Los Angeles als weltreporterin entdecken und erzählen kann.
Aber jetzt brauch ich erstmal nen Sekt. Oder besser noch nen Schnapps!
Ach nee, ist ja erst zehn Uhr morgens und die Arbeit wartet!